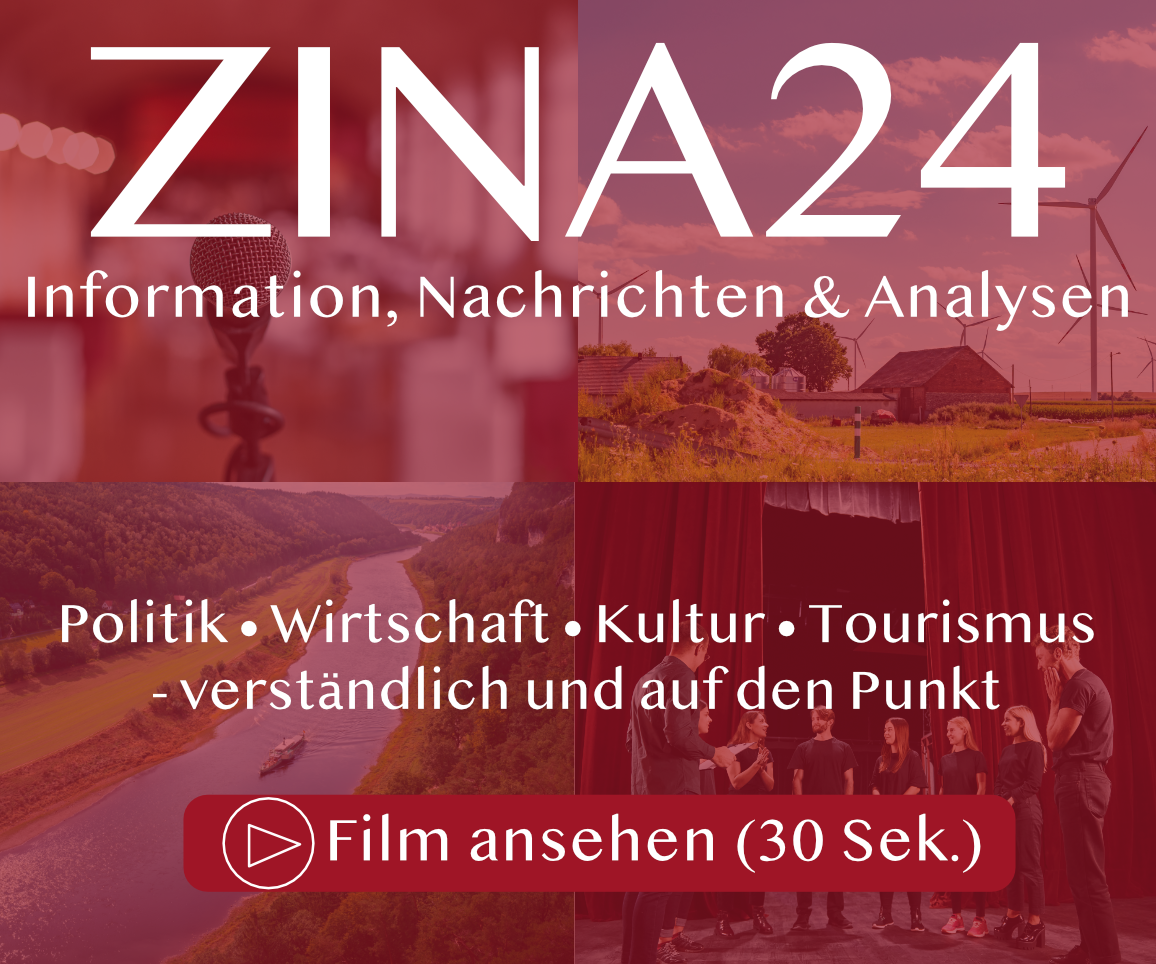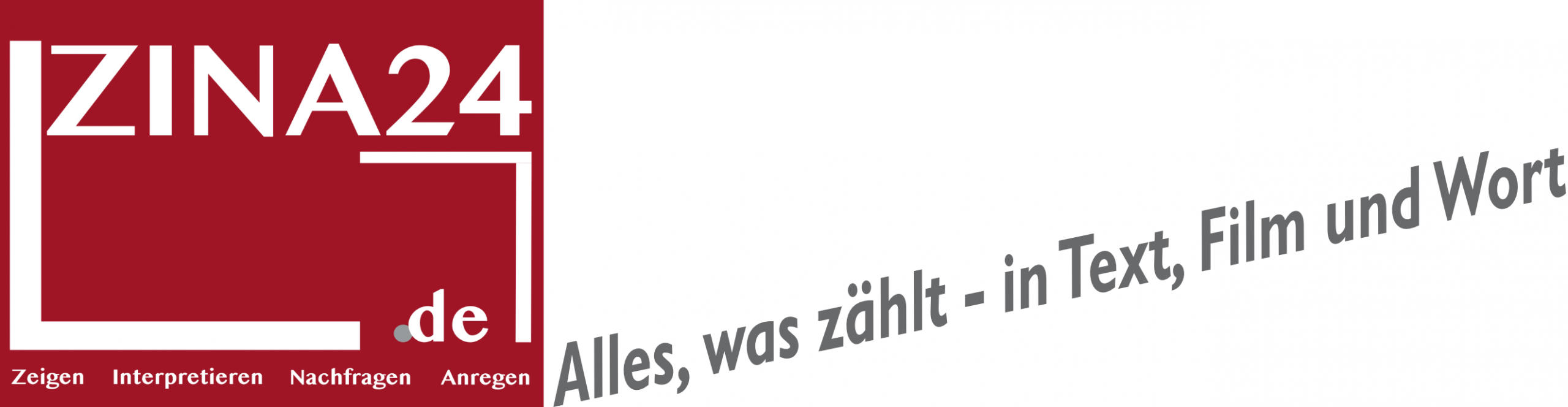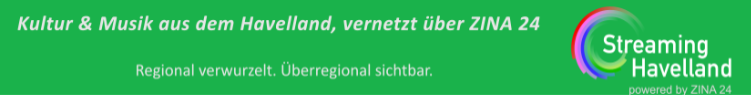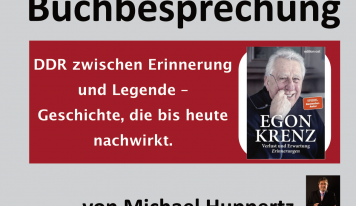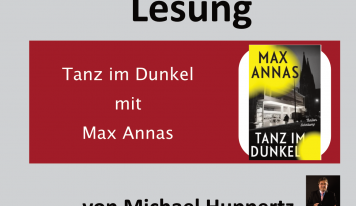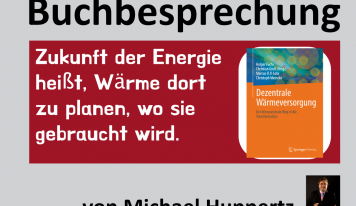ZINA24 hat das Werk von Dmitrij Trenin, Sergej Awakjanz und Sergej Karaganow zur Besprechung erhalten. Drei Autoren, die tief in der russischen Sicherheitselite verwurzelt sind: Dmitrij Trenin leitete viele Jahre das Moskauer Carnegie-Zentrum und berät außenpolitische Gremien; Sergej Awakjanz war Admiral und Oberbefehlshaber der russischen Pazifikflotte; Sergej Karaganow gilt als einflussreicher Vordenker der russischen Außenpolitik und war mehrfach Mitglied präsidialer Beratungsgremien. Ihre Nähe zu den Machtzentren macht deutlich: Hier handelt es sich nicht um ein akademisches Gedankenspiel, sondern um Positionen, die im Kreml Gehör finden.
Äußerlich erscheint das Werk als Buch, inhaltlich ist es die Druckfassung einer sicherheitspolitischen Denkschrift – eine Anleitung für russische Entscheidungsträger.
Veröffentlicht wurde es zunächst auf Russisch (Molodaja Gwardija, Moskau 2024), kurz darauf in einer autorisierten englischen Fassung (Moskau 2024) und schließlich in deutscher Übersetzung (WeltTrends, Potsdam 2025). Damit richtet sich die Publikation ausdrücklich an ein internationales Publikum.
Wir greifen das Werk auf, weil es zentrale Hinweise gibt, wie Moskau Abschreckung künftig versteht – und welche Bedingungen es für Frieden formuliert. Unser Verständnis ist: Erst wenn beide Seiten die Beweggründe, kulturellen und politischen Hintergründe des anderen erkennen, kann Diplomatie beginnen.
In einer Zeit, in der die Diskussion über Krieg und Frieden hoch emotional geführt wird, ist eine nüchterne Betrachtung besonders wichtig. Ziel dieser Besprechung ist es daher nicht, Verständnis für eine Seite zu erzeugen, sondern die Positionen offenzulegen. Auffällig ist, dass das Buch neben scharfen Drohungen auch Passagen enthält, die auf Stabilität abzielen. So heißt es: „Die Aufgabe besteht darin, die Gegner zu ernüchtern, nicht sie zu vernichten.“Zwischen der Rhetorik der „aktiven Abschreckung“ findet sich also auch der Gedanke, Koexistenz zu sichern – wenn auch unter Bedingungen, die klar aus Moskau heraus formuliert sind.
Wir bewegen uns damit in einer Phase, die an die gefährlichsten Momente des Kalten Krieges erinnert. Die Kuba-Krise 1962 gilt bis heute als Höhepunkt nuklearer Eskalation, als die Welt am Rand eines Atomkriegs stand. Auch die Auseinandersetzungen um den NATO-Doppelbeschluss der frühen 1980er Jahre zeigen, wie schnell Europa in den Fokus atomarer Drohungen geraten kann. Heute wie damals geht es um nukleare Abschreckung, um Rüstungskontrolle – und um die Frage, ob Diplomatie den Rückweg in stabile Verhältnisse finden kann.
Von passiver zu aktiver Abschreckung
Die Autoren beschreiben den Übergang von einer „passiven“ zu einer „aktiven Abschreckung“. Passiv bedeutet: Atomwaffen dienen der bloßen Vergeltung im Ernstfall. Aktiv bedeutet: Russland soll den Gegner gezielt einschüchtern, um ihn von Handlungen abzuhalten, die als Bedrohung der eigenen Interessen verstanden werden. Im Text heißt es: „Die Gründe für den Einsatz von Kernwaffen sind zu erweitern. Russland darf sie nicht nur bei einem Angriff auf das eigene Territorium einsetzen, sondern auch, wenn strategisch wichtige Interessen bedroht sind.“
Europa im Fokus
Europa – und darin insbesondere Deutschland – wird im Buch mehrfach hervorgehoben. Besonders deutlich wird dies in dem Satz: „Sollten die Vereinigten Staaten Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik stationieren, wird Deutschland zu einem prioritären Ziel nuklearer Schläge – bis hin zur vollständigen Vernichtung.“ Damit wird die Bundesrepublik explizit als Teil der strategischen Kalkulation benannt.
Ukraine als Prüfstein
Die Ukraine nimmt im Text eine Schlüsselrolle ein. „Russland muss den Krieg in der Ukraine in überschaubarer Frist gewinnen. Jede andere Option würde die Glaubwürdigkeit des Staates zerstören.“ Der Konflikt wird nicht als bilateraler Krieg dargestellt, sondern als Teil einer umfassenderen Auseinandersetzung: „Der Konflikt in der Ukraine ist Ausdruck der Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten und ihren Satelliten.“
Damit wird deutlich: Für die Autoren ist die Ukraine weniger ein eigenständiger Akteur als vielmehr ein Prüfstein für Russlands Großmachtstatus und für die künftige Sicherheitsordnung Europas.
BRICS und SCO als strategische Foren
Das Buch verweist neben der Auseinandersetzung mit dem Westen auch auf neue Bündnisse. BRICS und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) werden als tragende Säulen einer multipolaren Ordnung beschrieben: „Die Zusammenarbeit im Rahmen der BRICS sowie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit hat eine große Bedeutung für die Effektivität der Außen- und Sicherheitspolitik Russlands.“ Besonders hervorgehoben wird die Partnerschaft mit China. Europa wird hingegen als „Instrument der Vereinigten Staaten“ bezeichnet.
Rüstungskontrolle als Bestandteil der Strategie
Das Buch enthält neben den sicherheitspolitischen Verschärfungen auch Vorschläge für eine neue Sicherheitsarchitektur. Dazu zählen INF-ähnliche Vereinbarungen über die Nicht-Stationierung landgestützter Mittelstreckenraketen in Europa, Regelungen für den Weltraum, kernwaffenfreie Zonen sowie Transparenzmaßnahmen bei Manövern. Ein markanter Satz lautet: „Eine neue Vereinbarung über die Nicht-Stationierung landgestützter Mittelstreckenraketen in Europa könnte zur Grundlage einer stabilen Sicherheitsarchitektur werden.“
Militärische Stärke als Grundlage von Abschreckung
Die Autoren betonen, dass Abschreckung nur dann wirke, wenn sie militärisch untermauert sei. „Eine glaubwürdige Abschreckung setzt die Fähigkeit voraus, den Gegner unweigerlich und untragbar zu schädigen.“ Frieden und Sicherheit werden im Text damit unmittelbar an die Existenz wirksamer Waffen gebunden.
Fazit
„Von der passiven zur aktiven Abschreckung“ ist kein wissenschaftlicher Essay, sondern ein autorisiertes Strategiepapier. Es senkt die Schwelle für den möglichen Einsatz von Atomwaffen, stellt Europa – insbesondere Deutschland – ins Zentrum der strategischen Kalkulation, erklärt die Ukraine zum Prüfstein russischer Glaubwürdigkeit und hebt BRICS sowie SCO als neue Partner hervor. Gleichzeitig enthält es konkrete Vorschläge für Rüstungskontrolle, die neben den Forderungen nach militärischer Stärke stehen.
Das Buch dokumentiert damit die Spannungsfelder, in denen Diplomatie ansetzen müsste: zwischen Drohung und Gespräch, zwischen Abschreckung und Friedenssuche, zwischen Waffen und Verhandlungen. In dieser Mischung wird die Brisanz des gegenwärtigen Moments deutlich – ein Moment, der in seiner Gefährlichkeit an die Kuba-Krise von 1962 erinnert und für Deutschland von höchster Relevanz bleibt.
Anmerkung: Schlüsselbegriffe
Abschreckung
Prinzip, nach dem die Drohung mit untragbaren Gegenschlägen einen Angriff verhindern soll.
INF-Vertrag
1987 von USA und Sowjetunion geschlossen, verbot landgestützte Mittelstreckenraketen (500–5.500 km). Galt bis 2019.
BRICS
Staatengruppe Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika; inzwischen erweitert u. a. um Saudi-Arabien und Iran.
SCO (Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit)
Seit 2001 sicherheitspolitisches Forum von China, Russland und zentralasiatischen Staaten, inzwischen auch Indien, Pakistan und Iran. Kein Militärbündnis wie die NATO, keine gemeinsamen Waffenlager. Im Buch heißt es jedoch, es gelte, „die Ausdehnung von Militärblöcken und die Einrichtung von Militärstützpunkten entlang der Grenzen Russlands“ zu verhindern
Haftbefehl gegen Wladimir Putin
Der Internationale Strafgerichtshof (Den Haag) erließ 2023 einen Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine.
Verlag WeltTrends Link
„Von der passiven zur aktiven Abschreckung“
ISBN 978-3-949887-39-0
E-book (pdf) € 10,-
Druck € 19,50
Veranstaltung Eurasien Gesellschaft: Link