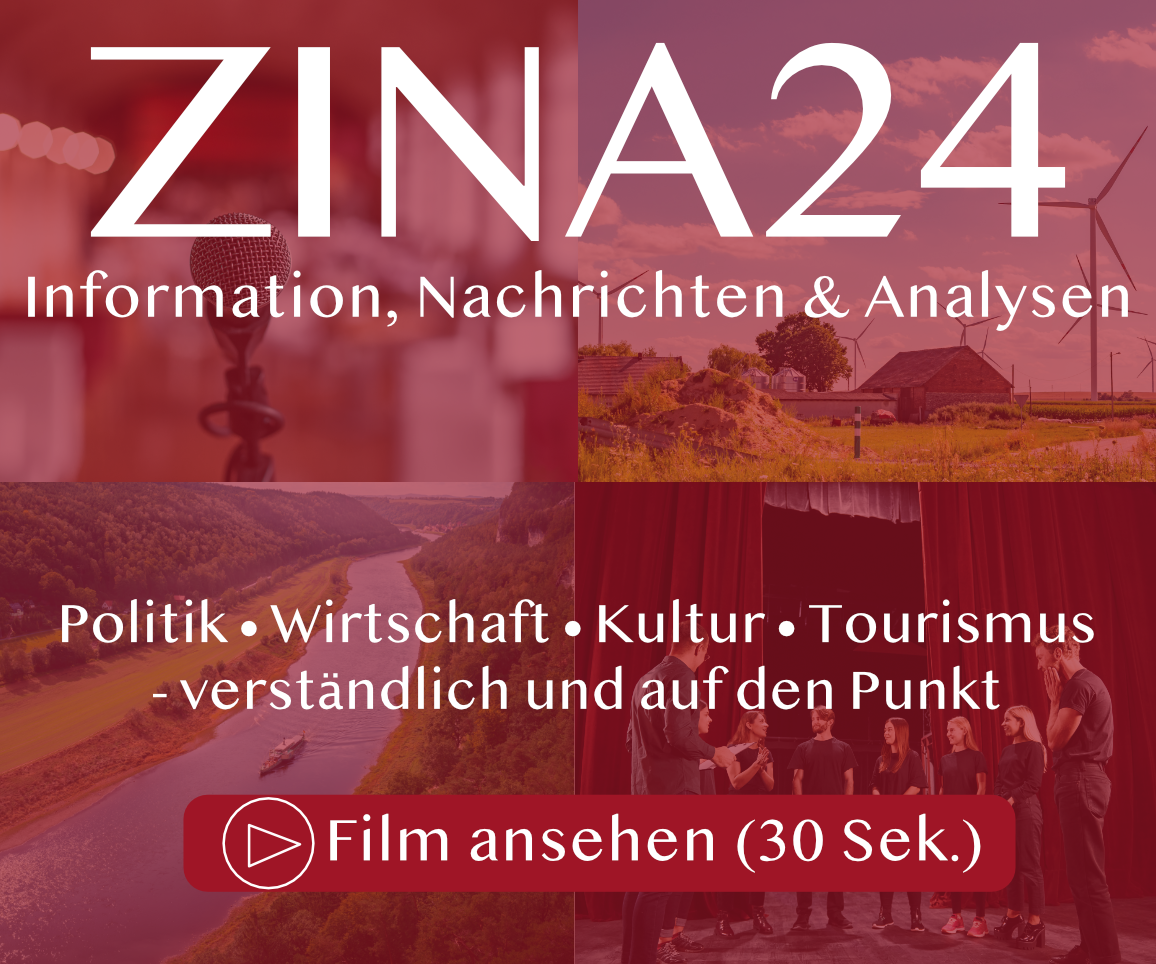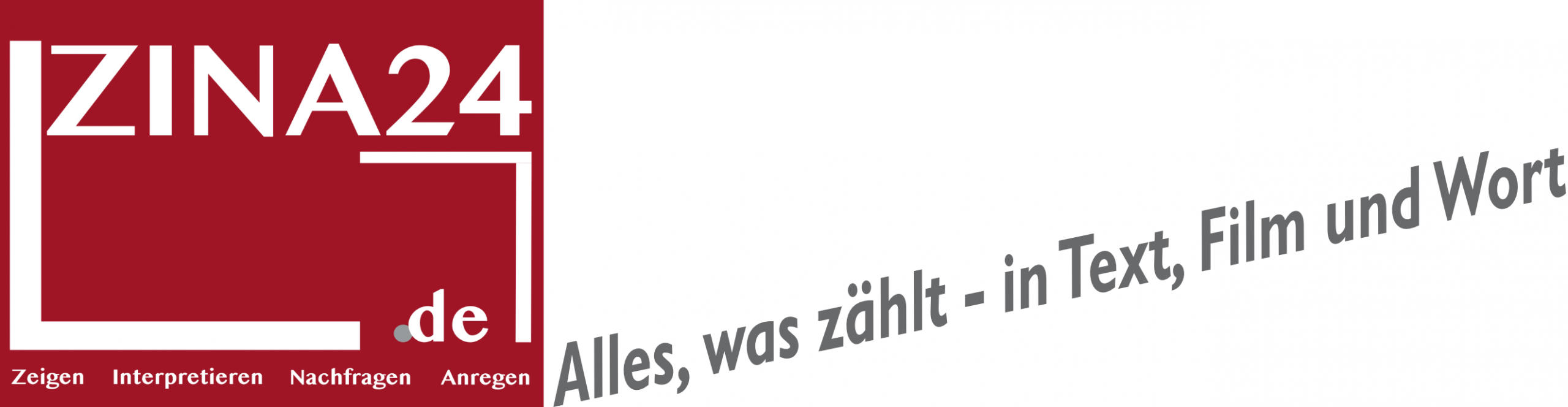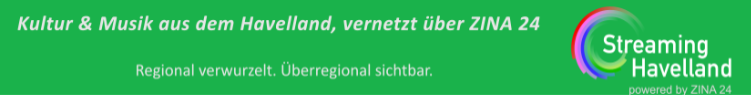Ein System am Limit
Das deutsche Gesundheitssystem steht unter Druck.
Das Bundesgesundheitsministerium warnt vor einer Zuspitzung: Ärztemangel, Klinikschließungen, steigende Pflegekosten – und ein wachsendes Defizit der gesetzlichen Krankenkassen.
Für 2025 rechnen Experten erneut mit Milliardenlücken in den Haushalten. Während Politik und Kassen nach strukturellen Lösungen suchen, wächst bei vielen Menschen das Bedürfnis, selbst mehr für die eigene Gesundheit zu tun.
Ein Begriff rückt dabei verstärkt in den Fokus: komplementäre Medizin.
Was komplementäre Medizin bedeutet
Komplementäre Medizin versteht sich nicht als Alternative, sondern als Ergänzung zur Schulmedizin.
Sie umfasst Verfahren wie Akupunktur, Phytotherapie, Osteopathie oder Methoden traditioneller Medizin aus anderen Kulturen – Ansätze also, die körperliche, psychische und soziale Faktoren gemeinsam betrachten.
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nutzen weltweit rund 60 Prozent der Bevölkerungregelmäßig komplementäre oder traditionelle Heilverfahren (1).
Viele Staaten haben diese Verfahren längst in ihre Gesundheitssysteme integriert, sie werden erforscht, reguliert und ausgebildet.
Deutschland dagegen agiert vorsichtiger: Zwar steigt die Nutzung in der Bevölkerung, doch in der Regelversorgung und Forschung bleibt der Bereich randständig (2, 3).
Warum Deutschland zögert
Dafür gibt es mehrere Gründe.
Erstens: Die Forschungsinfrastruktur ist begrenzt. Nur wenige Universitäten verfügen über Lehrstühle oder Institute für Komplementärmedizin (4).
Zweitens: öffentliche Förderprogramme sind selten. Seit einem kurzen Forschungsimpuls in den 2000er-Jahren mit rund 15 Millionen Euro wurden kaum vergleichbare Mittel bereitgestellt (5).
Drittens: Die Evidenzlage ist uneinheitlich. Während einige Verfahren – etwa Akupunktur bei chronischen Schmerzen – gut untersucht sind, fehlen bei anderen belastbare Studien (6).
Das erklärt, warum Krankenkassen nur ausgewählte Methoden über Satzungsleistungen erstatten und viele Kliniken komplementäre Verfahren nur auf Anfrage oder in Pilotprojekten anbieten (7).
Internationaler Vergleich und deutsche Zurückhaltung
In anderen Ländern sind komplementäre Ansätze deutlich stärker in die Gesundheitsversorgung eingebunden.
- Niederlande: In niederländischen Krankenhäusern bieten bis zu 90 Prozent mindestens eine Form komplementärer Therapie an – etwa zur Schmerz- oder Stressreduktion. Studien berichten von höherer Patientenzufriedenheit und besserer Behandlungsakzeptanz (8).
- Ghana: Das Gesundheitsministerium integriert traditionelle und komplementäre Verfahren gezielt in die Primärversorgung, um Zugänglichkeit und Qualität zu verbessern (9).
- Saudi-Arabien: Integrative Medizin wird staatlich gefördert, um Kosten zu senken und Patienten ganzheitlicher zu betreuen. Erste Auswertungen zeigen positive Rückmeldungen bei Ressourcennutzung und Therapietreue (10).
- Skandinavische Länder: In Norwegen und Dänemark existieren nationale Register und Forschungsprogramme, die Wirksamkeit und Sicherheit alternativer Therapien prüfen – eine Basis, die in Deutschland bislang fehlt (11).
Die WHO empfiehlt ihren Mitgliedsstaaten ausdrücklich, komplementäre Verfahren dort zu integrieren, wo Evidenz und Sicherheit vorliegen (1).
Länder mit klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen und Aus- bzw. Weiterbildungsstrukturen profitieren von breiterer Versorgung und geringeren Folgekosten bei chronischen Erkrankungen.
Deutschland bewegt sich hier langsamer. Die Zurückhaltung ist wissenschaftlich begründet, aber sie bremst auch Innovation.
Zwar nutzt laut einer repräsentativen Studie rund 70 Prozent der Deutschen mindestens einmal im Leben komplementäre oder integrative Verfahren, doch in der Ausbildung des medizinischen Personals, in Kliniken und bei der Forschung bleibt der Bereich fragmentarisch organisiert (12).
Entlastung durch Prävention
Der Gedanke, dass ergänzende Verfahren zur Entlastung des Gesundheitssystems beitragen könnten, gewinnt angesichts der angespannten Haushaltslage an Bedeutung.
Wenn Menschen durch bewussteren Lebensstil, Bewegung oder gezielte Prävention gesünder leben, sinkt langfristig die Zahl schwerer Krankheitsverläufe.
Komplementäre Medizin kann nicht alles lösen, aber sie kann dazu beitragen,
dass Patientinnen und Patienten besser mit chronischen Beschwerden umgehen,
Therapien unterstützt werden und invasive Eingriffe seltener nötig sind.
Sie ersetzt keine Notaufnahme und kein Medikament – doch sie kann verhindern, dass es so weit kommt.
Prävention – sinnvoll, aber selten erwünscht
In der Praxis zeigt sich, dass Prävention in Deutschland oft nicht am Wissen, sondern an Strukturen scheitert.
Ein Beispiel ist die Altenpflege: Inkontinenz zählt zu den häufigsten Diagnosen – behandelt wird meist medikamentös oder mit Hilfsmitteln.
Dabei gilt als belegt, dass ein gezieltes Beckenbodentraining Beschwerden in vielen Fällen deutlich lindern oder sogar beheben kann. Studien berichten von Heilungsraten von bis zu 90 Prozent, abhängig von Methode und Trainingsintensität (13).
Trotz dieser Datenlage ist das Verfahren nicht kassenfähig.
Es gilt als freiwillige Zusatzleistung, für die weder ein einheitlicher Erstattungssatz noch eine klare Zuständigkeit besteht.
Würden solche Maßnahmen regulär finanziert, könnten viele Pflegebedürftige ihre Selbstständigkeit zurückgewinnen – und in eine niedrigere Pflegestufe eingestuft werden.
Für das System wäre das kurzfristig sogar kostensenkend:
weniger Hilfsmittel, geringerer Personalaufwand, niedrigere Pflegepauschalen.
Verlierer wären jedoch die Einrichtungen selbst, deren Vergütung sich an Pflegestufen und Belegungsquoten orientiert.
Prävention kann damit ökonomisch nachteilig sein – nicht für das Gesundheitssystem, wohl aber für diejenigen, deren Einnahmen von der Dauer einer Erkrankung abhängen.
In einem System, das Krankheit besser vergütet als Gesundheit, wird Prävention wirtschaftlich zur Randerscheinung.
So entsteht ein struktureller Fehlanreiz, der das Offensichtliche ausbremst – obwohl Vorbeugung auf lange Sicht das günstigere und menschlichere Konzept wäre (14, 15).
Der Gesundheitsverbund Präventos e.V.
Der Gesundheitsverbund Präventos e.V. beschäftigt sich seit über zwei Jahrzehnten mit genau dieser Frage:
Wie lässt sich ein Gesundheitssystem denken, das Prävention ernst nimmt – nicht als Anhängsel, sondern als festen Bestandteil medizinischer Praxis?
Der Verbund arbeitet an der Schnittstelle von Prävention, Aufklärung und Forschung, bislang weitgehend im Hintergrund – mit Fachveranstaltungen, Weiterbildungen und Netzwerkarbeit zwischen Ärztinnen, Therapeuten und wissenschaftlichen Einrichtungen.
Mit der geplanten Präventos-Messe 2026 in Berlin soll dieses Thema noch stärker in die Öffentlichkeit rücken.
Die Messe versteht sich nicht als Fachkongress für Überzeugte, sondern als Plattform, auf der neue Verfahren vorgestellt, wissenschaftliche Erkenntnisse zugänglich gemacht und Brücken zwischen Schul- und Komplementärmedizin geschlagen werden.
Das Ziel ist nüchtern formuliert: Aufklärung statt Abgrenzung.
Der Verband will zeigen, dass Prävention kein Gegensatz zur klassischen Medizin ist, sondern deren logische Fortsetzung – und dass Aufklärung und Qualitätssicherung entscheidend sind, um diesen Anspruch gesellschaftsfähig zu machen.
Fazit
Die komplementäre Medizin bleibt ein umstrittenes, aber wachsendes Feld.
Während Länder wie die Niederlande, Norwegen oder Ghana längst verbindliche Strukturen geschaffen haben, steht Deutschland noch am Anfang.
Mit dem Gesundheitsverbund Präventos e.V. und der geplanten Messe in Berlin könnte sich das ändern –
nicht durch Dogmen, sondern durch Aufklärung, Forschung und den Willen, Gesundheit wieder als gemeinschaftliche Aufgabe zu verstehen.
Quellen / Literaturverweise
- WHO: Traditional, Complementary and Integrative Medicine
https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integrative-medicine - Hufelandgesellschaft: Forschung Integrative Medizin in Deutschland
https://www.hufelandgesellschaft.de/forschung-integrative-medizin/deutschland - Karger Verlag: Zur Lage der Komplementärmedizin in Deutschland
https://karger.com/fok/article/20/1/73/356590 - Bosch Health Campus: Robert Bosch Center for Integrative Medicine and Health
https://www.bosch-health-campus.de/en/institution/robert-bosch-center-integrative-medicine-and-health - Karger Verlag, ebd.
- Universität Heidelberg: Komplementärmedizin – Verfahren und Bewertung
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/verfahren/komplementaermedizin-206388 - Deutsche Krebsgesellschaft: Komplementäre Medizin – Möglichkeiten und Grenzen
https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/therapieformen/komplementaere-medizin-moeglichkeiten-und-grenzen.html - ScienceDirect: Integrative Medicine in Dutch Hospitals – A National Overview
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876382018310059 - WHO Feature: View from Ghana – Integration of TCIM with Primary Health Care
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/view-from-ghana–why-integration-of-tcim-with-primary-health-care-services-is-key - ScienceDirect: Integrative Medicine in Saudi Arabia: Implementation and Impact
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213422018301690 - Frontiers in Medicine: Integrative and Complementary Care in Scandinavian Systems
https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2024.1408653/full - BMC Public Health: Usage and Acceptance of TCIM in Germany (2025)
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-025-23908-5 - Deutscher Ethikrat (2023): Gesundheitliche Selbstbestimmung und ökonomische Fehlanreize in der Pflege
https://www.ethikrat.org/themen/gesundheitspflege/ - AOK-Bundesverband (2024): Prävention in der Pflege – Potenziale, Barrieren und Fehlanreize im Finanzierungssystem
https://www.aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2024/index_27552.html
#KomplementäreMedizin
#Prävention
#Gesundheitswesen
#Pflegepolitik
#Gesundheitsökonomie
#Gesundheitsverbund
#Präventos
#IntegrativeMedizin
#Gesundheitssystem
#PublicHealth