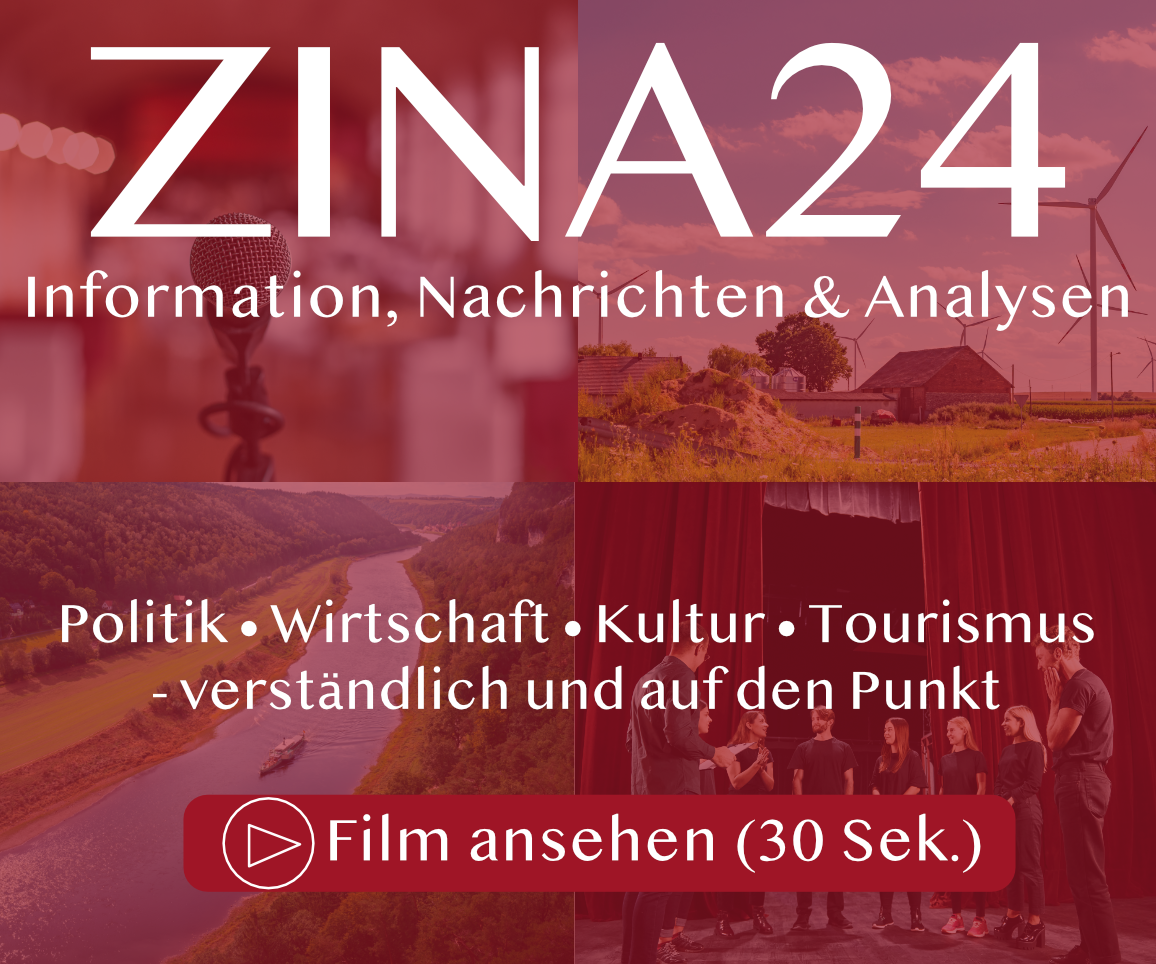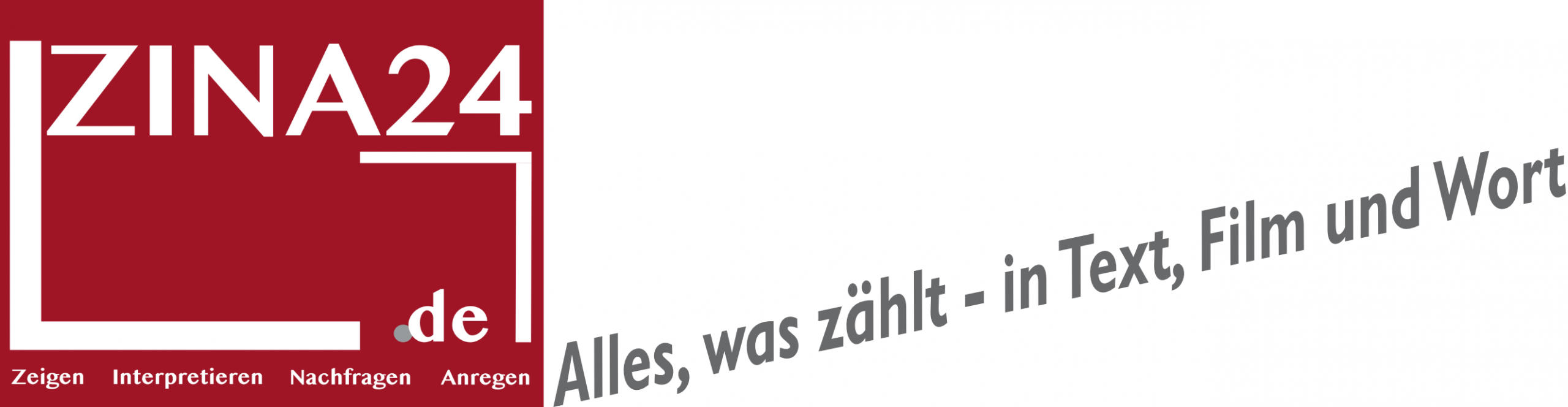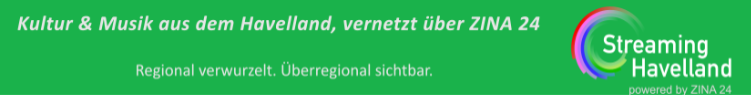In der deutschen Energiedebatte treffen zwei Welten aufeinander – die der schnellen Parolen und die der technischen Realität. Beide versprechen Sicherheit, beide beanspruchen Vernunft. Während Steffen Kotré, energiepolitischer Sprecher der AfD, einfache Lösungen anbietet – zurück zur Kohle, zurück zur Atomkraft –, sucht Katherina Reiche, Bundeswirtschafts- und Energieministerin, nach Wegen, den Umbau des Energiesystems stabil zu gestalten. Zwei Ansätze, die gegensätzlicher kaum sein könnten – und doch aus derselben Sorge geboren sind: Wie bleibt das Land versorgt, wenn Wind und Sonne Pause machen?
Wenn Schlagworte Politik ersetzen
Kotré warnt vor einem drohenden Blackout und behauptet, die erneuerbaren Energien gefährdeten die Versorgungssicherheit. Reiche setzt dagegen auf ein Konzept, das Brüssel skeptisch sieht: den Bau neuer Gaskraftwerke. Damit sollen Versorgungslücken überbrückt werden – schnell regelbar, theoretisch wasserstofffähig, in der Praxis jedoch mit fossilem Fundament.
Gas als Übergang – oder neue Abhängigkeit?
Was jahrelang als „Brückentechnologie“ galt, steht auf wackligen Pfeilern. Ein Teil des Erdgases, das künftig neue Kraftwerke antreiben soll, stammt nicht aus Europa, sondern wird als Flüssigerdgas (LNG) importiert – zunehmend auch aus den USA, wo ein großer Teil davon durch Fracking gewonnen wird.

Der Anteil von LNG an den gesamten deutschen Gasimporten liegt derzeit bei rund acht Prozent, doch innerhalb dieses Segments stammen etwa vier Fünftel aus den Vereinigten Staaten. Damit wächst eine neue Form der Abhängigkeit – politisch und technologisch.
Gleichzeitig bezieht Deutschland den größten Teil seines Erdgases weiterhin über Pipelines aus Norwegen und den Niederlanden, die 2024 zusammen fast drei Viertel der Versorgung stellten. Die wachsende Zahl schwimmender LNG-Terminals verändert dennoch die Struktur des Energiemarkts: Sie verlagert Abhängigkeiten und verstärkt die globale Preisbindung an den Spotmarkt.
Parallel dazu wird in Deutschland über CCS-Technologien (Carbon Capture and Storage) diskutiert – also die Abscheidung und unterirdische Speicherung von CO₂, insbesondere bei Industrie und Kraftwerken. Kritiker halten CCS für einen teuren Aufschub: Die Technik beseitigt Emissionen nicht, sondern verschiebt sie – und verlängert damit die Lebensdauer fossiler Brennstoffe unter grünem Etikett.
So entsteht ein Widerspruch im Herzen der Energiepolitik: Der Rohstoff, von dem Europa sich befreien wollte, soll nun die Energiewende absichern. Versorgungssicherheit ja – aber klimaneutral ist das noch lange nicht.
Sprachkampf um die Steckdose
In der Energiepolitik wird längst nicht nur mit Argumenten, sondern mit Worten gekämpft. Begriffe wie „Blackout„, „Ökodiktatur“, „Flatterstrom“ oder „Heizhammer“ werden von populistischen Kräften – vor allem aus dem Umfeld der AfD – gezielt eingesetzt, um Angst zu schüren und komplexe Themen zu emotionalisieren. Sie funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Wiederholung ersetzt Erklärung. Wer ständig von drohendem Stromausfall, Verbotswahn oder sozialer Kälte spricht, braucht keine Daten mehr – die Worte genügen, um Unbehagen zu erzeugen. Der Begriff „Dunkelflaute“ etwa, einst ein nüchterner Fachausdruck für Perioden mit wenig Sonne und Wind, wurde in der politischen Debatte zum Schreckenswort erhoben – als stünde das ganze Land kurz vor dem Blackout. Doch das Bild ist falsch: Auch in windstillen Nächten geht in Deutschland kein Licht aus. Denn das Stromsystem arbeitet längst mehrstufig und intelligent – Speicher, Biomasseanlagen, Laufwasserkraftwerke und flexible Reservekraftwerke gleichen Schwankungen aus, bevor sie überhaupt spürbar werden. Was früher eine reale Herausforderung war, ist heute eine Planungsaufgabe, nicht mehr das Ende der Zivilisation.
Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff „Flatterstrom“, der gern genutzt wird, um die Einspeisung erneuerbarer Energien als unkontrollierbar und chaotisch darzustellen. Tatsächlich aber bedeutet „Flatterstrom“ nichts anderes als zeitlich variable Einspeisung – also das natürliche Auf und Ab von Wind- und Sonnenstrom, das ebenfalls durch moderne Netzregelung, Speichermanagement und digitale Steuerung ausgeglichen wird. Das Netz flattert nicht – es „atmet“. Im europäischen Stromverbund wird jede Sekunde Spannung und Frequenz nachgeregelt. Erzeugung und Verbrauch müssen exakt im Gleichgewicht bleiben – sinkt die Frequenz unter 50 Hertz, wird automatisch nachgesteuert, steigt sie, werden Einspeisungen reduziert. Diese ständige Anpassung gleicht einem Atemrhythmus: ein Ein- und Auspendeln von Energieflüssen, das Stabilität erzeugt, nicht Chaos. Und diese Flexibilität ist keine Schwäche, sondern die Stärke eines Systems, das sich an die Natur anpasst, statt gegen sie zu arbeiten.
Gleichzeitig werden wissenschaftliche und technische Konzepte bewusst entstellt.
So wird das Energieerhaltungsgesetz – eine der grundlegendsten physikalischen Regeln – in Debatten gern zitiert, um die Energiewende als „wider die Natur“ zu brandmarken. Doch das Gesetz besagt nicht, dass Energie verloren gehen kann, sondern dass sie umgewandelt und gespeichert wird – genau das leisten moderne Speicher, thermochemische Reaktoren oder Wasserstoffsysteme jeden Tag. Energie verschwindet nicht. Sie wechselt nur die Form – so wie Gesellschaften, die bereit sind, sich zu verändern.
Auch Begriffe wie „Importabhängigkeit“, „Technologieneutralität“ oder „Klimadiktatur“ werden rhetorisch aufgeladen und aus dem Zusammenhang gelöst. „Technologieneutralität“ klingt vernünftig, wird aber oft als Deckmantel genutzt, um überkommene fossile Strukturen zu rechtfertigen. „Klimadiktatur“ wiederum ist reine Projektion – ein Versuch, notwendige politische Entscheidungen moralisch zu diskreditieren.
Das Ergebnis ist ein Klima der Polarisierung: Gefahren werden heraufbeschworen, die faktisch keine sind, während die reale Herausforderung – der Umbau zu einem stabilen, klimafreundlichen und technisch intelligenten Energiesystem – in den Hintergrund tritt. Narrative ersetzen Wissen. Mythen verdrängen Maß. Und wer an der Steckdose Angst hat, sieht nicht, wie viel Intelligenz längst im Netz steckt.
Wiederholung ersetzt Wahrheit – Innovation ersetzt Angst
Doch während Populisten Mythen wiederholen, arbeiten andere längst an Lösungen. Ingenieure, Forscherinnen und Stadtwerke entwickeln tagtäglich Systeme, die genau jene Probleme angehen, mit denen rechte Parolen Stimmung machen.
Ein Beispiel sind die Großspeicherprojekte von Tesvolt und RWE, die überschüssige Windenergie aufnehmen und bei Bedarf binnen Sekunden wieder einspeisen. Solche Batteriespeicher verhindern, dass Strom verloren geht, wenn Sonne und Wind zu viel liefern. Sie machen das Netz nicht instabil, wie Kritiker behaupten, sondern elastisch – und sorgen dafür, dass Energie dort landet, wo sie gebraucht wird.

Fertigungslinie in TESVOLTs
Gigafactory in Lutherstadt Wittenberg.
(Quelle: TESVOLT)
Noch entscheidender aber ist der Umbau der Netze selbst. Denn es geht dabei längst nicht mehr nur um mehr Kupfer in der Erde oder im Freileitungsbau , sondern um intelligente Steuerung und Automatisierung. Moderne Leittechnik misst Spannung, Frequenz und Lastflüsse in Echtzeit, steuert Umspannwerke, verteilt Energie digital und verhindert Überlastungen, bevor sie entstehen. Die Netzbetreiber Amprion und 50Hertz testen bereits KI-basierte Systeme, die Verbrauch und Einspeisung vorausschauend steuern – das Stromnetz wird so zu einem lernfähigen Organismus, der nicht mehr nur verteilt, sondern denkt.
Die deutsche Automatisierungs- und Zulieferindustrie erlebt dadurch einen weltweiten Aufschwung. Unternehmen wie Phoenix Contact (Detmold), Siemens Energy (Erlangen), WAGO (Minden) oder Rittal (Herborn) liefern heute die Module, Sensoren und Steuerungssysteme, mit denen Energienetze in über fünfzig Ländern modernisiert werden. Auch mittelständische Spezialisten wie Beckhoff Automation oder Helmholz GmbH exportieren Smart-Grid-Technologien von Bayern bis Brasilien.
Damit hält Deutschland in einem hochsensiblen Wirtschaftsbereich einen Trumpf in der Hand: Ohne deutsche Steuer-, Regel- und Leittechnik würden viele Stromnetze der Welt schlicht nicht stabil funktionieren. Was einst als Ingenieurskunst begann, ist heute ein entscheidender Baustein globaler Energiesicherheit – made in Germany.
In einer Zeit, in der über Lieferketten und Abhängigkeiten gestritten wird, lohnt sich ein Blick auf die Gegenseite:
So wie die deutsche Automobilindustrie auf Halbleiter aus Asien wartet, sind zahlreiche Länder von deutscher Netztechnik abhängig. Was, wenn eines Tages die Steuerungstechnik aus Deutschland ausbliebe – Leitsysteme, Netzschutzmodule, Frequenzregler? Dann stünden nicht Fließbänder, sondern ganze Stromnetze still. Globalisierung bedeutet wechselseitige Verwundbarkeit – und zugleich gemeinsame Verantwortung.
Parallel dazu entstehen neue Industriezweige, die aus Reststoffen Energie erzeugen und CO₂-Neutralität praktisch umsetzen.
Die Blue Energy Group AG etwa entwickelt thermochemische Reaktoren, die aus Klärschlamm, Biomasse oder Kunststoffabfällen synthetisches Gas mit hohem Brennwert gewinnen. Das dabei entstehende Produkt ist ein Erdgasersatz, der im Gegensatz zu importiertem Fracking-Gas CO₂-neutral erzeugt wird – regional, skalierbar und auch ohne Subventionen. In der Gesamtbilanz kann diese Technologie einen relevanten Beitrag zum Gasmarkt leisten, da sie fossile Importe ersetzt und zugleich das Abfallproblem reduziert. Was anderswo unter hohem Energieaufwand aus dem Boden gepresst wird, entsteht hier aus dem, was ohnehin anfällt –Kreislaufwirtschaft im besten Sinn. Damit auch kein CCS erforderlich.
Deutsche Energietechnologien stoßen heute international auf ebenso großes Interesse wie im eigenen Land – auch eurasische Staaten wie die Mongolei informieren sich über Lösungen, die Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und regionale Energieautarkie miteinander verbinden.

Besuch des mongolischen Botschafters in Deutschland S.E. Dr. Mandakhbileg bei der Blue Energy Group AG in Senden bei Ulm.
Im Hintergrund ist der Forschungsreaktor mit einer Leistung von 1 Megawatt zu sehen – Sinnbild deutscher Ingenieurkunst, die weltweit Beachtung findet und im letzten jähr mit dem Deutschen Nachhaligkeitspreis prämiert sowie als Top 100 Unternehmen „Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet wurde. (Foto : Blue Energy Group)
Solche Technologien machen Deutschland nicht nur unabhängig, sondern zugleich unverzichtbar.
Viele Länder sind inzwischen auf deutsche Netz-, Steuerungs- und Energietechnik angewiesen – vom Energiemanagement in Skandinavien bis zur Spannungsregelung in Südkorea. Das ist stille Macht – keine, die auf Dominanz zielt, sondern auf gegenseitige Abhängigkeit.
Die neue Weltenergieordnung zeigt: Jede Nation braucht vom anderen, was sie selbst nicht hat – Know-how, Rohstoffe, Technologie. Deutschland liefert dabei das, was man nicht lagern kann, aber dringend braucht: Verlässlichkeit durch Ingenieurskunst.
Ingenieurskunst und Medienverantwortung
Als der Journalist Axel Bojanowski in der WELT die Sprengung der Kühltürme von Gundremmingen mit der Zerstörung der Buddha-Statuen von Bamiyan verglich, traf er einen Nerv – und verfehlte zugleich die Wahrheit.
Der Vergleich war eindrucksvoll, aber journalistisch fahrlässig. Denn die Sprengung war kein symbolischer Akt, sondern die Folge eines Gesetzes, das bereits 2011 unter der damaligen CDU/FDP-Regierung beschlossen und von SPD und Grünen mitgetragen wurde: das Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung. Es markierte den politisch und gesellschaftlich vereinbarten Atomausstieg – nicht dessen Zerstörung.

Nach rund 45 Sekunden waren die 160 Meter hohen Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen Geschichte. „Wir kommen unserem gesetzlichen Auftrag zum zügigen Rückbau der Anlage in Gundremmingen seit Januar 2018 in Block B und seit Januar 2022 in Block C nach. Der erfolgreiche Abbruch der beiden Kühltürme ist nun auch ein nach außen sichtbarer Beleg, dass wir den politisch beschlossenen Kernenergieausstieg konsequent umsetzen“, erklärt Steffen Kanitz, als Vorstandsmitglied der RWE Power AG zuständig für die Sparte Kernenergie.
Foto/Text: RWE
Und doch hat der Vergleich unfreiwillig etwas offenbart: Wo Bojanowski das Ende einer Epoche sah, begann tatsächlich eine neue. Denn auf demselben Gelände, auf dem die Kühltürme fielen, errichtet RWE seit Januar 2024 einen Großbatteriespeicher mit einer Kapazität von rund 700 Megawattstunden. Er soll künftig überschüssige Energie aus Wind- und Solarkraft aufnehmen und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen – ein Beitrag zur Netzstabilisierung und Versorgungssicherheit. Der Ort, an dem einst Atomstrom produziert wurde, wird damit zum Symbol des Übergangs:
Von der Kernkraft zur Speicherkraft.
Ironischerweise war es also keine Sprengung, die das Ende markierte, sondern ein Spatenstich, der den Beginn einer neuen Energieära einläutete. Dort, wo früher Dampf aufstieg, entsteht heute Speicherkapazität für ein erneuerbares Energiesystem. Was als Verlust interpretiert wurde, ist in Wahrheit Fortschritt. Energie, einfach anders gedacht.
Umso irritierender ist, dass gerade Bojanowski, der 2024 vom Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler für seine publizistischen Leistungen ausgezeichnet wurde und Bücher wie „Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten“ veröffentlichte, in einem Leitmedium mit solcher Abfälligkeit über Symbolik und Energiepolitik schreibt. Wer wissenschaftliche Aufklärung als Beruf versteht, sollte sich nicht der Sprache bedienen, die er sonst kritisiert.
Journalisten tragen Verantwortung, aufzuklären statt zu polarisieren. Wenn ein Chefredakteur historische Bilder bemüht, um die Energiewende zu dramatisieren, überschreitet er die Grenze zwischen Deutung und Demagogie. In der Energiepolitik kursieren seit Jahren Angstnarrative – „Blackout-Gefahr“, „Kostenlawine“, „Verbotspolitik“. Sie stammen aus rechten Echokammern, werden dort emotional aufgeladen und schließlich von seriösen Medien übernommen. So wird das, was eigentlich erklärt werden müsste, zum Echo populistischer Rhetorik. Und wenn Leitmedien beginnen, diese Narrative weiterzutragen, verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit – und ihre eigentliche Aufgabe: die Unterscheidung zwischen Meinung, Macht und Wahrheit.
Fazit – wo die wahre Dunkelflaute liegt
Die Dunkelflaute existiert, aber nicht dort, wo sie beschworen wird. Sie liegt nicht in den Stromleitungen, sondern in den Köpfen. Wer über Energie spricht, sollte wissen, dass Versorgungssicherheit kein Zufall ist, sondern das Resultat von Planung, Technik und Ingenieurskunst. Schon heute stammen über 60 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen – Wind, Sonne, Wasser, Biomasse und Geothermie. Das ist kein Versprechen, sondern Realität.
Bei der Wärme hingegen steht die Energiewende erst am Anfang: Der Anteil erneuerbarer Energien liegt hier bei rund 19 Prozent. Doch das ist Stoff für einen eigenen Artikel – über das nächste große Kapitel der Transformation, das jenseits der Steckdose beginnt.
Die Dunkelflaute ist kein physikalisches, sondern ein mentales Phänomen. Sie entsteht dort, wo Angst die Argumente ersetzt. Deutschland steht nicht vor einem Energie-Kollaps, sondern mitten in einer Erfolgsgeschichte, die nur selten erzählt wird: dem Umbau zu einem der sichersten, stabilsten und modernsten Stromsysteme der Welt.
Wer heute Angst schürt, verrät das Vertrauen in Vernunft. Wer sich informiert, erkennt: Wissen ist die beste Energiequelle gegen Populismus.
Kommentar von Dr. Christian Groß
Vorstandsmitglied VDE Rhein Main
Regional Direktor EMEA „IEEE“
sehr interessanter Artikel. Kleiner Hinweis …Gleichstrom (DC)-Einspeisungen von Photovoltaikanlagen können die Frequenzsteuerung erschweren, da sie nicht in gleicher Weise wie herkömmliche Drehstrom-Kraftwerke zur Frequenzhaltung beitragen. Der Wechselrichter wandelt Gleichstrom in Drehstrom um, was eine Frequenzsteuerung in traditioneller Form erschwert, da die Leistung nicht direkt auf die mechanische Drehzahl der Generatoren reagiert.
Gründe für die Erschwernis
Direkte Anbindung an die Frequenzregelung: Die Frequenz im Stromnetz wird durch das Gleichgewicht zwischen Einspeisung und Verbrauch von elektrischer Energie aufrechterhalten. Traditionelle Kraftwerke mit Generatoren reagieren direkt auf Frequenzschwankungen: Steigt die Frequenz, werden die Generatoren leicht abgebremst, sinkt sie, werden sie beschleunigt.
Umwandlung in Wechselstrom: Photovoltaikanlagen speisen zunächst Gleichstrom ein, der durch Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Diese Umwandlung findet unabhängig von den mechanischen Generatoren statt und trägt nicht direkt zur Frequenzhaltung bei.
Unvorhersehbare Schwankungen: Die Einspeisung aus PV-Anlagen schwankt mit dem Sonnenschein und ist daher schwer vorhersehbar. Dies kann die Frequenz des Netzes stärker beeinflussen und die Aufgabe der Frequenzregelung für die Netzbetreiber erschweren.
Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderung
Regelbare Wechselrichter: Moderne Wechselrichter können eine Rolle bei der Frequenzhaltung spielen, indem sie ihre Leistung anpassen oder sogar Blindleistung liefern, um Spannungsspitzen zu vermeiden.
Ausbau der Netze: Der Netzausbau kann helfen, die Effekte von dezentralen Einspeisungen abzumildern.
Intelligente Steuerung: Intelligente Steuerungssysteme und die Kommunikation zwischen Einspeisern und Netzbetreibern ermöglichen eine bessere Koordination und Stabilität des Stromnetzes.
Abregelungsmechanismen: In bestimmten Fällen kann der Netzbetreiber die Einspeisung von PV-Anlagen vorübergehend drosseln, um Netzüberlastungen zu verhindern.
Quellen:
1. Offizielle Regierungs- und Statistikquellen
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) – Energiedaten: Gesamtausgabe (Stand 2025)
- Bundesnetzagentur – Monitoringbericht Energie 2024
- Statistisches Bundesamt (Destatis) – Energieerzeugung in Deutschland 2024
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) – Klimaschutzbericht 2024
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) – Förderinitiative Speichertechnologien und Smart Grids
2. Forschung, Institute und Think-Tanks
- Agora Energiewende – Deutschland vor der Klimaneutralität: Jahresbericht 2024
- Fraunhofer ISE – Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland (Stand Februar 2025)
- Internationale Energieagentur (IEA) – Global Energy Review 2025
- Clean Energy Wire (CLEW) – China’s Energy Policy and Carbon Neutrality Target 2060
3. Verbände, Netzbetreiber und Fachorganisationen
- Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) – Whitepaper Netzsicherheit 2030
- Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) – Positionspapier Smart Grids und Netzautomatisierung 2024
- Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) – Energieversorgung 2025: Zahlen, Fakten, Analysen
4. Industrie, Technologie und Energieunternehmen
- Blue Energy Group AG – Thermochemische Reaktoren, Blue Energy Stick: CO₂-neutrale Energiegewinnung aus Reststoffen und Klärschlamm
- Tesvolt GmbH – Industrielle Batteriespeicherlösungen zur Netzstabilität und Eigenstromversorgung in Mittelspannungssystemen
- Amprion GmbH – Netzausbauprojekte (SüdLink, A-Nord) und Smart Grid Steuerungstechnologien für Übertragungsnetze
- 50Hertz Transmission GmbH – Versorgungsstabilität, Einspeisemanagement und Integration erneuerbarer Energien im Nordostverbund
- Siemens Energy AG – H₂-ready-Gasturbinen, Sektorkopplung, Hybridkraftwerke und Leittechnik für Smart Grids
- Prysmian Group – Supraleitende Hochspannungs- und Seekabelsysteme für Stromübertragung (u. a. NordLink, SüdOstLink)
- RWE AG – Batteriespeicher Gundremmingen (700 MWh), Solarpark 55 ha, H₂-ready-Spitzenlastkraftwerk, Energieinfrastrukturprojekte in Süddeutschland
- ABB Deutschland – Automatisierungs- und Schaltanlagentechnik, Netzleittechnik und Smart-Grid-Systemintegration
- WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – Steuerungs- und Automatisierungslösungen für Energienetze, dezentrale Einspeisung und Lastmanagement
- Phoenix Contact GmbH & Co. KG – Energieautomatisierung, Sensorik und Kommunikationslösungen für Netzüberwachung und Spannungsregelung
- Eaton Electric GmbH – Energieverteilung, Lastmanagement und Schutztechnik in Industrie- und Netzsystemen
- Schneider Electric Deutschland – Digitale Energieplattformen, Netzmanagement und Automatisierung für Versorger und Industrie
- Wieland Electric GmbH – Energieverteilung, Gebäudetechnik und Sicherheitssysteme im Bereich Stromnetze
- Weidmüller Interface GmbH & Co. KG – Verbindungstechnik, Datenübertragung und Condition Monitoring in Energiesystemen
5. Medien, Projekte und Regionalquellen
- RWE AG – Spatenstich für Deutschlands größten Batteriespeicher in Gundremmingen (Pressemitteilung, März 2025)
- Donau3FM – RWE baut in Gundremmingen Deutschlands größten Batteriespeicher – Spatenstich nach Sprengung der Kühltürme (13. März 2025)
- Augsburger Allgemeine – RWE plant Solarpark und Gaskraftwerk in Gundremmingen (14. März 2025)
- dpa – Deutsche Presse-Agentur – Deutschlands größter Batteriespeicher entsteht in Gundremmingen – Söder und Krebber beim Spatenstich (13. März 2025)
- Bayerische Staatskanzlei – Rede von Ministerpräsident Markus Söder beim Spatenstich für den RWE-Speicher Gundremmingen (2025)