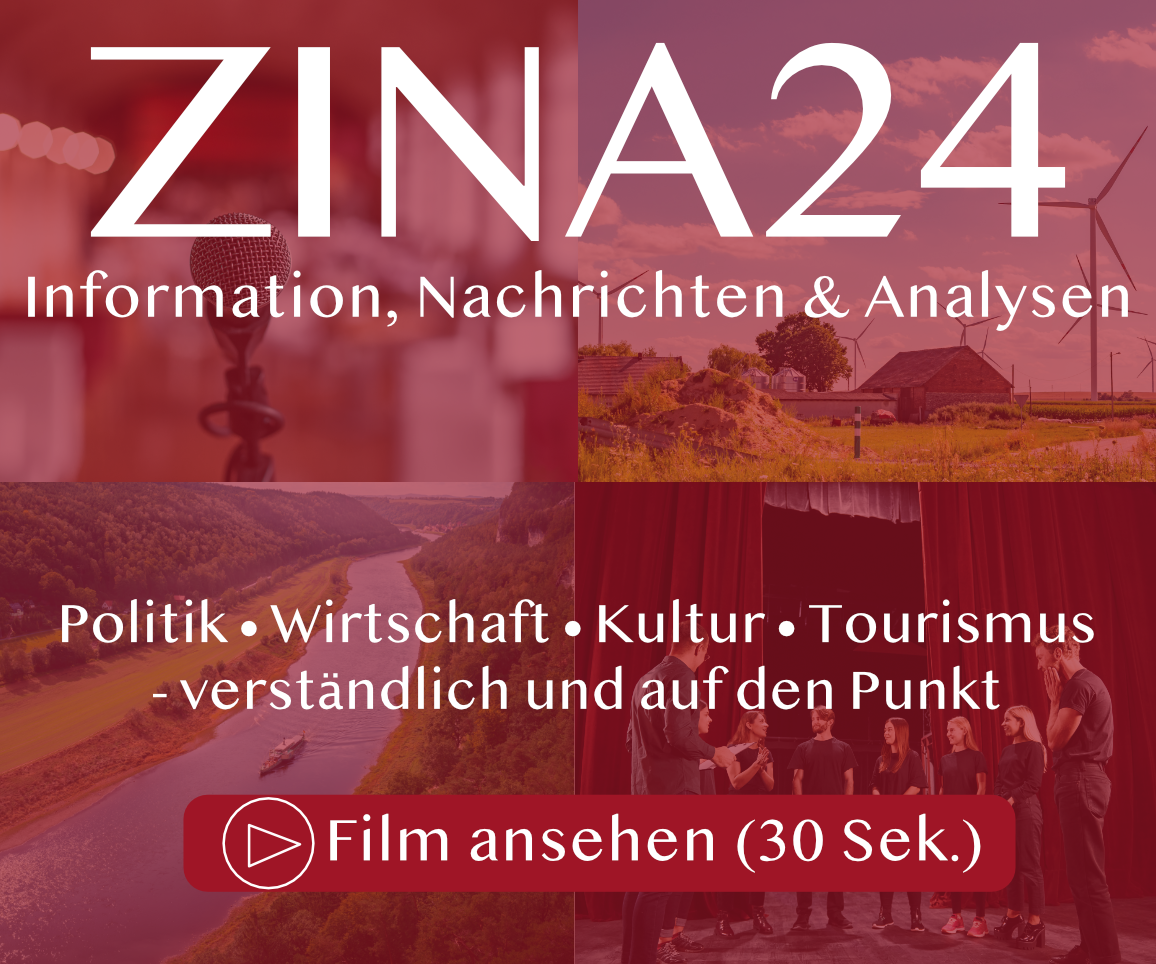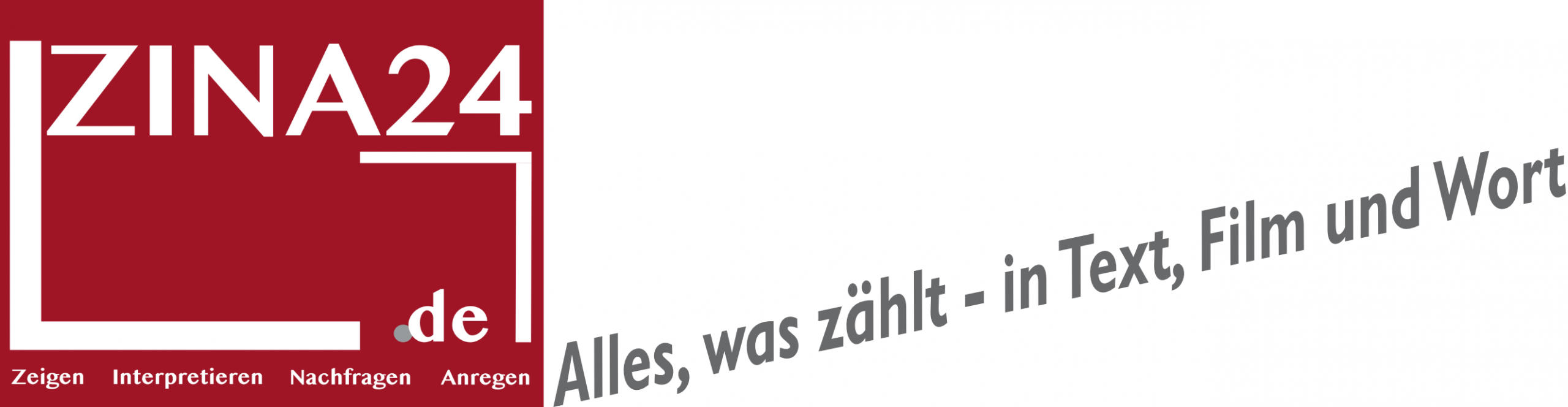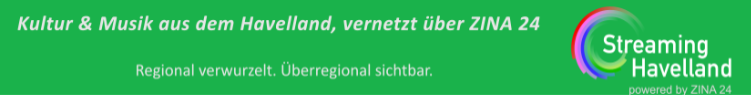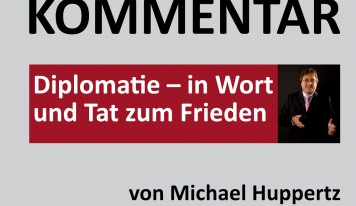Ein Kommentar von Michael Huppertz
Wenn Köpfe rollen, weil Stillstand zu teuer wird
Die neue Bahnchefin Evelyn Palla hat sich von der DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta getrennt. Ein Gutachten hatte dem Sanierungskonzept der Güterverkehrstochter mangelnde Wirkung attestiert – nach über fünf Jahren Arbeit kein Fortschritt, keine Kehrtwende, keine Gewinne. Europa drängt, Brüssel fordert Ergebnisse, ab 2026 muss die DB Cargo endlich profitabel werden. Die Folge: Köpfe rollen, Menschen werden ausgetauscht. Doch dieser Vorgang steht für mehr als nur die Krise eines Konzerns. Er zeigt, was geschieht, wenn Verantwortung zu lange verwaltet statt gestaltet wird – und wann Stillstand teurer wird als Veränderung. Die Wirtschaft reagiert auf Druck, weil sie muss. Aber was wäre, wenn Politik denselben Mut zur Konsequenz hätte – ganz ohne Brüssel? Wenn nicht externe Gutachter, sondern gesunder Menschenverstand der Antrieb wäre? Denn Demokratie ist kein Selbstläufer. Auch sie braucht neue Player – Macher statt Verwalter, Menschen, die gestalten statt reagieren.
Brandenburg: Demokratie mit kurzem Atem
Und genau hier lohnt der Blick nach Brandenburg.
Dort fanden in den vergangenen Wochen Bürgermeisterwahlen statt – und sie endeten mit einem eindeutigem Ergebnis pro Demokratie. Noch, denn in allen Kommunen setzten sich demokratische Kandidaten durch. Kein Rathaus, kein Amt, kein Sessel an die AfD – ein starkes Signal.
Doch die Geschichte endet nicht mit dem Jubel. Kaum waren die Stimmen gezählt, begann das gewohnte Echo: AfD-Landeschef René Springer wetterte gegen die Briefwahl, sprach von Manipulation und erklärte die Demokratie kurzerhand zum Betrugssystem.
Binnen Minuten rauschte die Botschaft durchs Netz – gezielt, laut, effektiv.
So funktioniert die neue Gewaltenteilung: Wer den Algorithmus beherrscht, braucht kein Argument mehr.
Und was taten viele Demokraten? Sie feierten – zurecht. Doch während die Konfetti noch fielen, verstummte die Bewegung.
Zufrieden mit sich selbst, als wäre der Wahlsieg schon der Schutz. Dabei beginnt die eigentliche Arbeit jetzt – nicht erst mit dem Amtseid.
Jetzt ist die Zeit für Präsenz, für Ideen, für Kreativität, für Zeichen, die zeigen: Wir warten nicht, wir handeln. Denn Demokratie lebt nicht vom Amtsstempel, sondern vom Aufbruch.
Von Washington bis Wittenberge – die gleiche Dramaturgie
Doch wer verstehen will, was in Brandenburg passiert, muss über die Landesgrenzen hinausblicken. Denn die Mechanismen, die Demokratien schwächen, sind überall dieselben – ob in Potsdam, Paris oder Washington. Populismus kennt keine Postleitzahl. Er arbeitet mit denselben Werkzeugen: Lautstärke, Angst, Dauerempörung. Darum lohnt der Blick nach Amerika – dorthin, wo das Muster zuerst perfektioniert wurde.
Donald Trump hat vorgemacht, wie man Demokratien mit Lärm erschüttert und Wahrheiten zur Nebensache erklärt. Sein Stratege Steve Bannon schrieb das Drehbuch: Provokation, Opferrolle, Dauerpräsenz. Und genau dieser Bannon hat später auch die AfD beraten – direkt oder indirekt, aber mit spürbarer Wirkung. Das gleiche Drehbuch, dieselbe Dramaturgie, nur mit deutschem Untertitel. Die AfD spielt heute die europäische Variante: gleiche Feindbilder, gleiche Methoden, dasselbe Ziel – nicht regieren, sondern dominieren. Demokratische Politiker reagieren darauf, als ginge es um Anstand, nicht um Haltung. Sie antworten mit Sachlichkeit auf Lautstärke – und wundern sich, warum keiner zuhört. Aber Vernunft, die flüstert, geht im Getöse der Wut unter. Wer den Raum nicht besetzt, überlässt ihn den Lautesten. Und genau hier schließt sich der Kreis – von Washington zurück nach Berlin und Brandenburg, von der Weltpolitik zur Provinz. Denn Haltung ist keine Frage der Bühne, sondern der inneren Überzeugung. Ob Weltbühne oder Rathaus – wer führt, muss stehen können, wenn der Wind dreht.
Kneipen, Kultur – und der wahre Ort der Demokratie
Aber zurück nach Brandenburg. Weg von Gipfeln und Krisenräten, hin zu den Orten, an denen Demokratie wirklich lebt – oder langsam verschwindet. Denn während in der Weltpolitik über Despoten, Sanktionen und Strategien debattiert wird, zeigt sich der wahre Zustand der Demokratie oft dort, wo keiner mehr hinschaut: im Dorf, im Wirtshaus, im Alltag. In Brandenburg wird das Kneipensterben beklagt.
Nicht, weil man Bier vermisst, sondern Begegnung. Diese Orte waren einst das soziale Rückgrat des Landes – heute verwaisen sie.
Zwar wurde das Problem inzwischen politisch erkannt, Fördergelder zugesagt – doch sie greifen spät und zu kurz. Warum also nicht leerstehende Gaststätten wiederbeleben – gemeinsam mit Wirten, die in der Corona-Zeit ihre Existenz verloren haben? Solche Orte könnten mehr sein als Wirtschaftsbetriebe: Treffpunkte der Kulturen, Orte neuer Speisen, neuer Geschichten, neuer Nachbarschaften.
Sie könnten zeigen, wie Integration wirklich funktioniert – am Tisch, nicht am Talkshow-Pult.
Und sie ließen sich sichern, wenn Politiker selbst mitziehen – als Zugpferde, Mitstreiter und, ja, auch Mitfinanzierer.
Nicht als Spender, sondern als Investoren in das, was sie politisch vertreten: das öffentliche Leben.
Politik mit Nähe statt mit Phrasen
Natürlich sind nicht nur einzelne Politiker gefragt, die sich finanziell beteiligen. Gefragt sind auch jene, die finanzielle Kreativität fördern – durch regionale Fonds, die genau das ermöglichen: den Erhalt und die Wiederbelebung dieser Orte und ihrer Betreiber. Viele Kneipenwirte haben in der Corona-Zeit alles verloren – Umsatz, Gäste, Perspektive. Jetzt wäre es an der Zeit, ihnen etwas zurückzugeben: nicht als Almosen, sondern als Investition in Begegnung, Kultur und Gemeinsinn. Denn diese Häuser sind mehr als Wirtschaftsbetriebe – sie sind Brücken zwischen Generationen, Kulturen und Lebenswelten. Wer sie stärkt, stärkt auch die Künstler, Musiker, Vereine und Initiativen, die dort auftreten und den sozialen Kitt am Leben halten. Die Linke macht es seit Jahren vor: sie legt Diätenerhöhungen in einen parteiinternen Fonds, aus dem soziale oder gemeinnützige Projekte finanziert werden – direkt, nachvollziehbar, ohne Bürokratie. Das ist nicht Symbolpolitik, sondern gelebte Verantwortung. Warum übernehmen das andere demokratische Parteien nicht längst – ebenso wie regionale Landes- und Bundesmandatsträger, die aus ihren Diäten einen Anteil für genau solche Projekte bereitstellen könnten? Gerade dort, wo die Distanz zwischen Politik und Alltag wächst, könnte ein solcher Schritt Vertrauen schaffen – sichtbar, glaubwürdig, anfassbar.
Der Bürgermeister, der nicht aufgibt
Einer, der genau diese Unterstützung braucht, ist Luca Piwodda, der 25-jährige ehrenamtliche Bürgermeister von Gartz an der Oder – einer Stadt, die exemplarisch steht für viele Orte im Osten, in denen Zuversicht keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Das gesellschaftliche Klima ist angespannt, geprägt von Misstrauen, politischer Müdigkeit und den Spuren rechtsextremer Einflussnahme.
Piwodda begegnet dem nicht mit Abgrenzung, sondern mit Nähe. Er spricht mit allen – auch mit jenen, die sich längst von der Politik entfremdet haben. Er versucht, sie zurückzuholen: mit Offenheit, Geduld und Haltung. Und EHRENAMTLICH. Piwodda kämpft um seine Stadt – um Arbeitsplätze, Familien, Freizeit, Kultur – kurz: um Zukunft. Und er tut das ohne Apparat, ohne Parteistruktur, ohne Rückendeckung. Nur mit dem Glauben daran, dass Veränderung von unten beginnt. Es ist diese Art von Lokalpolitik, die man selten sieht und noch seltener würdigt: mutig, beharrlich, leise und trotzdem wirksam. Piwodda steht nicht für den Rückzug, sondern für Aufbruch – für das, was Demokratie im besten Sinne ausmacht: Verantwortung übernehmen, wo andere längst weggesehen haben.
Ein Brennglas für die Republik
Und gerade darin liegt der Prüfstein für die etablierten demokratischen Parteien. Denn mit Reden ist hier nichts getan. Gartz ist kein Einzelfall, sondern ein Brennglas. Eine Blaupause für den Osten – und, wenn man ehrlich ist, für die ganze Republik: verwaiste Innenstädte, geschlossene Läden, entleerte Dörfer. Was fehlt, ist nicht der Wille, sondern die Unterstützung, die endlich Aufschwung, Stabilität und Zukunft bringt.
Wenn Vertrauen zur Währung wird
Was also verbindet Briefwahlen, Kneipen und die AfD mit demokratischen Politikern? Vielleicht dies: In allen drei Fällen geht es um Vertrauen – darum, wer es sich erarbeitet, wer es verliert und wer glaubt, es sei selbstverständlich. Briefwahlen zeigen, dass Demokratie funktioniert, wenn Bürger Verantwortung übernehmen. Kneipen zeigen, dass sie verschwindet, wenn Begegnung fehlt. Und die AfD zeigt, was passiert, wenn Politik zu lange schweigt.
Zeit, Köpfe und Haltung zu wechseln
Darum gilt jetzt mehr denn je:
Politiker, die reden, gibt es genug.
Politiker, die anpacken, viel zu wenige.
Politiker, die alles unter Beweis stellen wollen – deren Zeit läuft.
Denn wer heute zaudert, wird morgen abgewählt – im Glücksfall wie bei einer Lotterie auf einer Landesliste gelandet, befördert nach dem Peter-Prinzip: hochgespült trotz fehlender Leistung. Doch genau das kann sich die Demokratie nicht mehr leisten – dafür steht zu viel auf dem Spiel.
Müssen also am Ende doch Köpfe ausgewechselt werden, damit wieder Tatkraft statt Taktik regiert?
Die Investition, die sich lohnt
Darum gilt jetzt: keine Ausreden, kein Abwarten mehr. Vertrauen entsteht nicht im Ausschuss, sondern im Alltag. In Gesprächen, in Begegnungen, in Präsenz. In Wahlen – auch bei der Briefwahl –, die zeigen, dass Demokratie lebt. In Kneipen, wo Menschen sich begegnen. Und im Widerstand gegen jene, die Demokratie abschaffen wollen.
Denn wer sich einbringt, investiert – nicht nur in Mandate, sondern in Glaubwürdigkeit. Diese Investition zahlt sich doppelt aus: in Wiederwahl und in Wertschätzung. Am Ende gewinnt nicht der Lauteste, sondern der, der Haltung zeigt – und damit der Demokratie ihren verdienten Zoll entrichtet.
Und auch die Bürger spüren das. Sie danken es mit Vertrauen, Beteiligung – und manchmal einfach damit, dass sie wieder wählen gehen. Demokratisch.
Am Ende verbindet Wahlen, Kneipen und Politik nur eines:
Sie funktionieren nur, wenn jemand hingeht – und nicht nur meckert, dass nichts los ist.
Quellen und Hintergrundmaterial
1. Wirtschaft & DB Cargo
- Handelsblatt, 10.10.2024: „DB Cargo: Bahnchefin Evelyn Palla trennt sich von Sigrid Nikutta – Sanierungskonzept gescheitert.“
- FAZ, 11.10.2024: „Warum die Güterbahn nicht aus der Krise kommt – und Brüssel Druck macht.“
- Tagesspiegel Background Mobilität & Verkehr, 12.10.2024: „EU drängt auf Sanierung der DB Cargo – Milliardenverluste gefährden Schienengüterverkehr.“
2. AfD, Populismus & Steve Bannon
- Süddeutsche Zeitung, 14.07.2018: „Wie Steve Bannon Europas Rechte vernetzt – Kontakte zur AfD und Lega Nord.“
- Die Zeit, 07.10.2023: „Die Methode Bannon – Warum die AfD amerikanische Strategien kopiert.“
- Tagesschau.de, 09.06.2024: „AfD und Desinformation: Wie sich rechte Netzwerke im Internet organisieren.“
3. Politische Kultur & Engagement in Brandenburg
- RBB24 Recherche, 20.09.2024: „Bürgermeisterwahlen in Brandenburg: Demokraten gewinnen, AfD scheitert.“
- Potsdamer Neueste Nachrichten, 22.09.2024: „Luca Piwodda in Gartz – Der junge Bürgermeister, der nicht aufgibt.“
- Der Spiegel, 25.09.2024: „Im Osten nichts verloren – wie Kommunen gegen den Rechtsruck ankämpfen.“
4. Kneipensterben, Kultur und regionale Wirtschaft
- Fraunhofer ISI, 2022: Kultur- und Nachtökonomie als regionaler Wirtschaftsfaktor.
Belegt den Multiplikatoreffekt von Gastronomie- und Kulturorten auf regionale Wertschöpfung. - Deutscher Kulturrat, Kulturwirtschaftsbericht 2023: „Begegnung schafft Bindung – Kulturelle Orte als soziale Infrastruktur.“
- ZEIT Online, 15.04.2023: „Wenn das Dorf dichtmacht – Warum das Kneipensterben gefährlicher ist, als viele glauben.“
5. Demokratie, Engagement & politische Kommunikation
- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), 2023: Vertrauen in die Demokratie – Wie politische Präsenz das Wahlverhalten beeinflusst.
- Friedrich-Ebert-Stiftung, 2022: Politische Teilhabe im ländlichen Raum – Die Bedeutung kommunaler Begegnungsorte.
- Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), 2021: Kommunen und Bürgerbeteiligung – Strategien gegen Politikverdrossenheit.
6. Brandenburg & AfD-Äußerungen zur Briefwahl
- Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ), 19. Oktober 2025: „Niederlage bei Bürgermeisterwahlen: AfD-Chef Brandenburg fordert Abschaffung der Briefwahl“.
– AfD-Landeschef René Springer kritisiert die Briefwahl nach verlorenen Bürgermeisterstichwahlen und bezeichnet sie als manipulationsanfällig. - Süddeutsche Zeitung, 20. Oktober 2025: „AfD-Landeschef nach Stichwahlen gegen Briefwahl“.
– Bericht über Springers Forderung nach Abschaffung der Briefwahl und die Reaktionen demokratischer Parteien in Brandenburg.