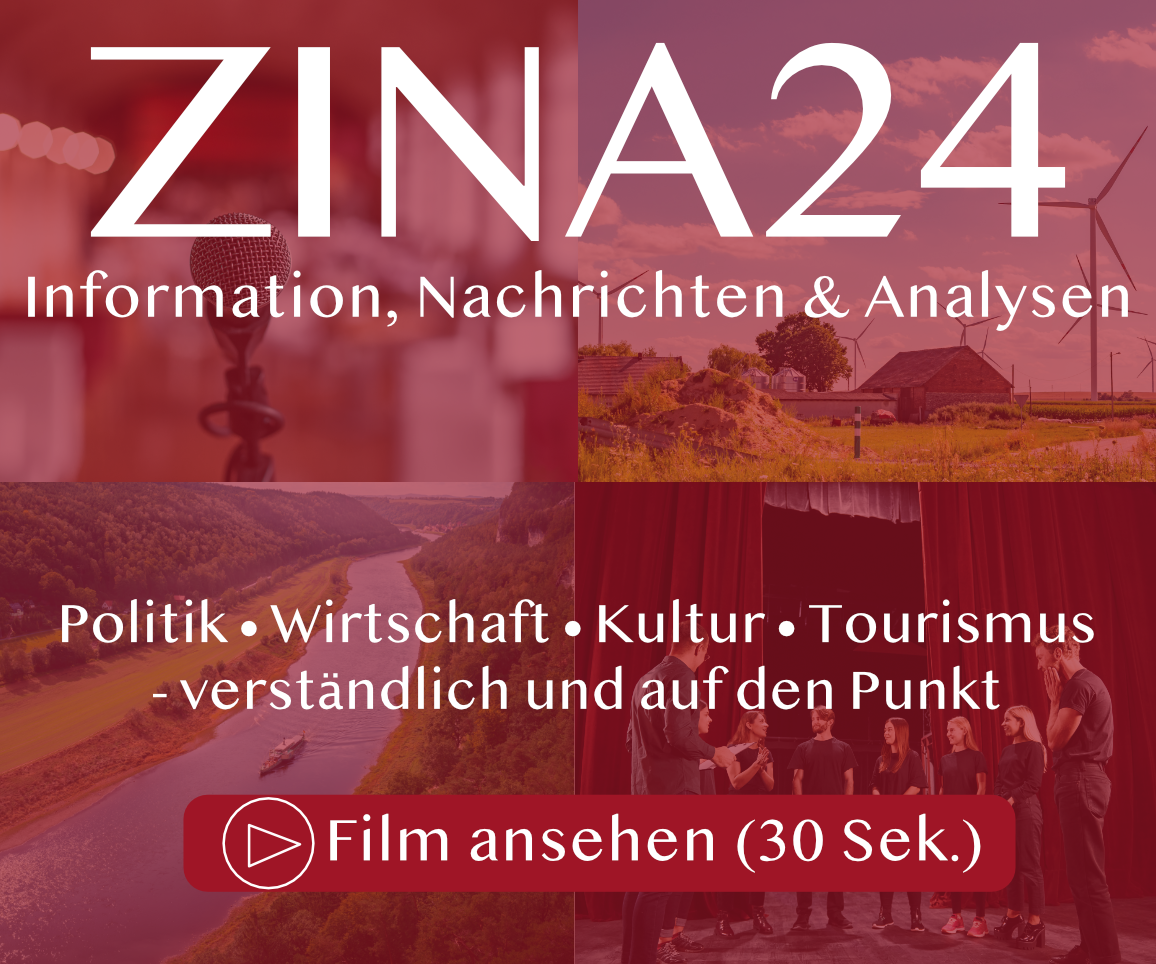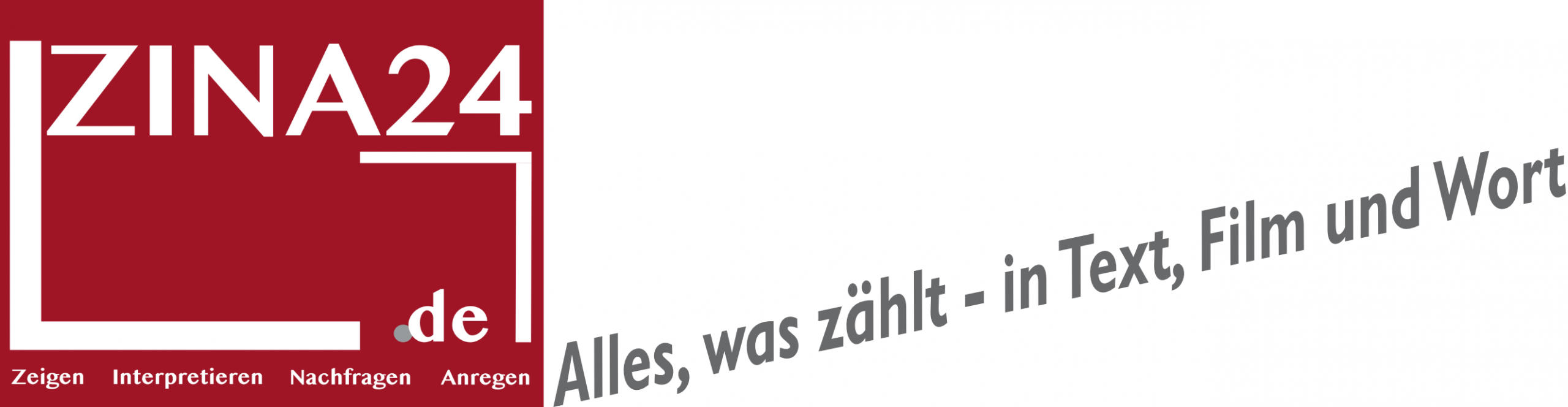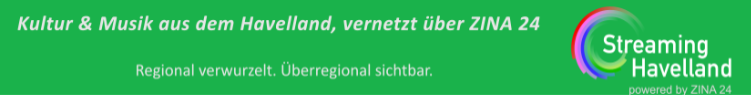Die AfD hat die Sprache verändert, die demokratischen Parteien haben zu spät reagiert. Nun droht der Ton der Rechten zum neuen Normal zu werden – und mit ihm das Ende jener Brandmauer, die das Land bislang vor dem moralischen Absturz bewahrte.
Wie die AfD den Diskurs kaperte
Es begann harmlos. Mit Wörtern wie „Alternativlosigkeit“ und „Euro-Rettung“ spaltete sich 2013 eine „Professorenpartei“ von der Union ab. Doch aus der wirtschaftsliberalen Kritik wurde binnen weniger Jahre eine kulturelle Bewegung – eine, die nicht nur Themen, sondern Begriffe besetzte. Begriffe wie „Altparteien“, „Lügenpresse“, „Asylchaos“, „Umvolkung“ und „Meinungsdiktatur“ wanderten aus Foren und Facebookgruppen in Talkshows und Parlamentsprotokolle. Damit verschob sich der Rahmen des Sagbaren – Stück für Stück, Satz für Satz.
Die Politikwissenschaftler Olbrich und Banisch sprechen von einer „Rekonfiguration des politischen Raumes“. Die AfD, schreiben sie, habe „den Diskurs nicht nur thematisch erweitert, sondern semantisch kolonisiert“. Wer über Migration, Energie oder Identität spreche, spreche heute oft schon im Vokabular der Rechten [1].
Die schleichende Sprachverrohung
Was mit neuen Wörtern begann, wurde zum neuen Ton. Der Satz „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“verwandelte sich in eine Art rhetorisches Schutzschild gegen Kritik. Die Sprache wurde gröber, direkter, verletzender – in sozialen Netzwerken erst, dann in Kommunalparlamenten, später im Bundestag.
Aus dem Begriff „Rückführung“ wurde „Remigration“, aus „Kritik an Migration“ ein „Kampf um das Stadtbild“. Diese semantische Eskalation schafft Identität durch Ausgrenzung – und zerstört den gesellschaftlichen Kitt, der Demokratie zusammenhält. Der Psychologe Andreas Zick nennt das „Lizensierung der Verachtung“: Wenn Menschen ständig abgewertet werden, erscheint ihre Diskriminierung irgendwann als legitim [2]. In Onlineforen lässt sich das beobachten: Das Abwertende wird zum Applauszeichen, das Gemeine zur Pointe.
Die Brandmauer – das letzte Bollwerk
Die sogenannte Brandmauer zwischen demokratischen Parteien und der AfD war lange unangefochten. Sie symbolisierte die moralische Grenze – keine Kooperation, keine gemeinsamen Anträge, keine Relativierung rechtsextremer Rhetorik. Doch seit die AfD in ostdeutschen Kommunen mit absoluten Mehrheiten operiert, bröckelt die Mauer. Immer häufiger fallen Sätze wie: „Man muss ja mit allen Demokraten reden.“ Nur: Die AfD ist keine normale Partei. Sie ist ein Projekt der Aushöhlung – von Sprache, Institution und Mitmenschlichkeit.
Transparency Deutschland warnte jüngst:
„Eine Zusammenarbeit mit der rechtsextremen und antidemokratischen AfD darf niemals eine Option sein. Die Brandmauer wurde durchbrochen – dies ist eine traurige Zäsur. Demokratinnen und Demokraten müssen sie stärken, statt Feuer zu legen.“ [3]
Die Brandmauer schützt nicht Parteien – sie schützt Prinzipien. Sie ist der Filter, der verhindert, dass Ressentiment zur Regierungssprache wird.
Der Potsdam-Moment – Sprachlosigkeit an der Regierungsspitze
In Potsdam fiel in dieser Woche ein Satz, der vieles bündelt. CDU-Chef Friedrich Merz sagte:
„Wir haben natürlich im Stadtbild noch dieses Problem … und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, Rückführungen zu ermöglichen.“ [4]
Daneben stand Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke – und nickte.
„Besonders befremdlich ist, dass SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke schweigend daneben stand und bei diesen Aussagen auch noch zustimmend nickte. Die SPD ist einmal mit einer klaren Kante gegen Rechts angetreten – doch von dieser Haltung ist nichts mehr zu spüren. Woidke schwieg mal wieder, wo Haltung gefragt gewesen wäre. “
Clemens Rostock, Landesvorsitzender der Brandenburger Bündnisgrünen
Das war kein Zufall, sondern ein Symptom. Denn der Satz traf ausgerechnet jene Stadt, deren Identität auf Offenheit und Integration gründet. Potsdam verdankt seinen Aufstieg dem Edikt von 1685, mit dem der Große Kurfürst verfolgte Hugenotten ins Land holte. Sie brachten Wissen, Handwerk und Innovation. 2008 wurde dieses Edikt symbolisch erneuert – als Erinnerung daran, dass Toleranz die Grundlage brandenburgischer Kultur und Wirtschaft ist [5].
Das Potsdamer Edikt von 1685 war mehr als ein Gnadenakt – es war eine Investition in Generationen. Rund 20.000 Hugenotten fanden in Brandenburg-Preußen Zuflucht, brachten Wissen, Handwerk und Unternehmenskultur und ließen sich nieder, um neu zu beginnen. Erst ihre Kinder und Enkel wurden Teil der brandenburgischen Gesellschaft – ein Prozess, der Jahrzehnte dauerte und das Land dauerhaft prägte. Heute aber urteilt man über Migration im Rhythmus von Wahlperioden und Schlagzeilen, als ließe sich Zugehörigkeit in fünf Jahren abwickeln. Das Edikt erinnert daran, dass Integration keine Sofortmaßnahme ist, sondern ein Generationenvertrag – und dass Geduld die wertvollste Form politischer Weitsicht ist.
Michael Huppertz, Anmerkung des Autors
Und nun? Ein Satz über „Probleme im Stadtbild“ – mitten in dieser Stadt der Zuflucht. Ein Satz, der den Geist des Edikts ins Gegenteil verkehrt. Wenn der Vorsitzende einer Volkspartei Migration im selben Atemzug mit „Stadtbild“ nennt, spuckt er nicht nur auf die Geschichte, er nährt die Ideologie, die sie einst zerstörte. Dass ein Ministerpräsident daneben nickt, zeigt, wie tief die Normalisierung bereits reicht. Wenn selbst in der Hauptstadt der Toleranz der Ton der Ausgrenzung salonfähig wird, ist die Brandmauer nicht mehr Symbol, sondern Trümmerfeld.
Warum die Brandmauer jetzt verteidigt werden muss
Sprache schafft Realität. Wer Begriffe der AfD wie „Remigration“, „Bevölkerungsaustausch“ oder „Sozialtourismus“ unwidersprochen stehen lässt, erlaubt die politische Umcodierung der Wirklichkeit. Demokratie zerfällt nicht durch Gesetze, sondern durch Gewöhnung.
Die Verteidigung der Brandmauer ist auch eine ökonomische Notwendigkeit. Im AfD-Programm wird Migration fast ausschließlich als Belastung dargestellt [6]. Das ist ökonomischer Selbstmord. Deutschland altert rapide, Fachkräfte fehlen, Unternehmen wandern ab. Zuwanderung ist kein Risiko, sondern das, was Brandenburg und Deutschland seit Jahrhunderten stark gemacht hat – vom Hugenotten bis zum Ingenieur der Gegenwart.
Die AfD will Subventionen für Umwelt, Bildung und soziale Programme streichen und nur noch „Leistungsträger“ fördern. Damit trifft sie die Mitte der Gesellschaft – die kleinen und mittleren Betriebe, die Forschung, Pflege, Handwerk und Technologie tragen. Eine solche Politik schwächt nicht den Staat, sondern seine Zukunftsfähigkeit.
Und schließlich: Die Brandmauer ist auch ein moralisches Bauwerk. Sie schützt nicht bloß Parteien, sondern Menschenwürde. Wer danebensteht und nickt, wenn Ausgrenzung zum Stadtbild erklärt wird, sendet ein Signal: Der Ton ist akzeptabel. Doch jedes Nicken in der Mitte ist ein Applaus von rechts.
Die Brandmauer muss bleiben
In Potsdam sprach der CDU-Chef und Bundeskanzler Merz vom „Problem im Stadtbild“ – und der Ministerpräsident nickte. Das war kein Zufall, sondern ein Symbol: Die Brandmauer fällt nicht in einem großen Knall, sie bröckelt im Schweigen. Wenn Politiker Begriffe der AfD übernehmen, übernehmen sie mehr als Worte. Sie übernehmen eine Weltsicht.
Die Brandmauer muss bleiben – nicht aus Prinzip, sondern aus Verantwortung. Denn sie schützt nicht nur Parteien, sondern das Fundament, auf dem dieses Land steht: Geschichte, Würde und Vernunft.
Quellen
1 E. Olbrich & S. Banisch, The Rise of Populism and the Reconfiguration of the German Political Space, Frontiers / arXiv, 2022
2 A. Zick, Lizensierung der Verachtung: Über soziale Erosion und politische Enthemmung, Universität Bielefeld, 2021
3 Transparency Deutschland, Pressemitteilung „Brandmauer darf nicht fallen“, 2025
4 Friedrich Merz, Rede in Potsdam, 15. Oktober 2025, zitiert nach Tagesspiegel, rbb24, ZDF heute Journal
5 Neues Potsdamer Edikt, Staatskanzlei Brandenburg (2008); Merz/Woidke-Auftritt, rbb24, 17. Oktober 2025
6 AfD-Grundsatzprogramm 2024, Kapitel „Migration und Demografie“, Absätze 3–6
Link Potsdamer Edikt 1685: http://www.potsdam.de/de/das-edikt-von-potsdam-von-1685