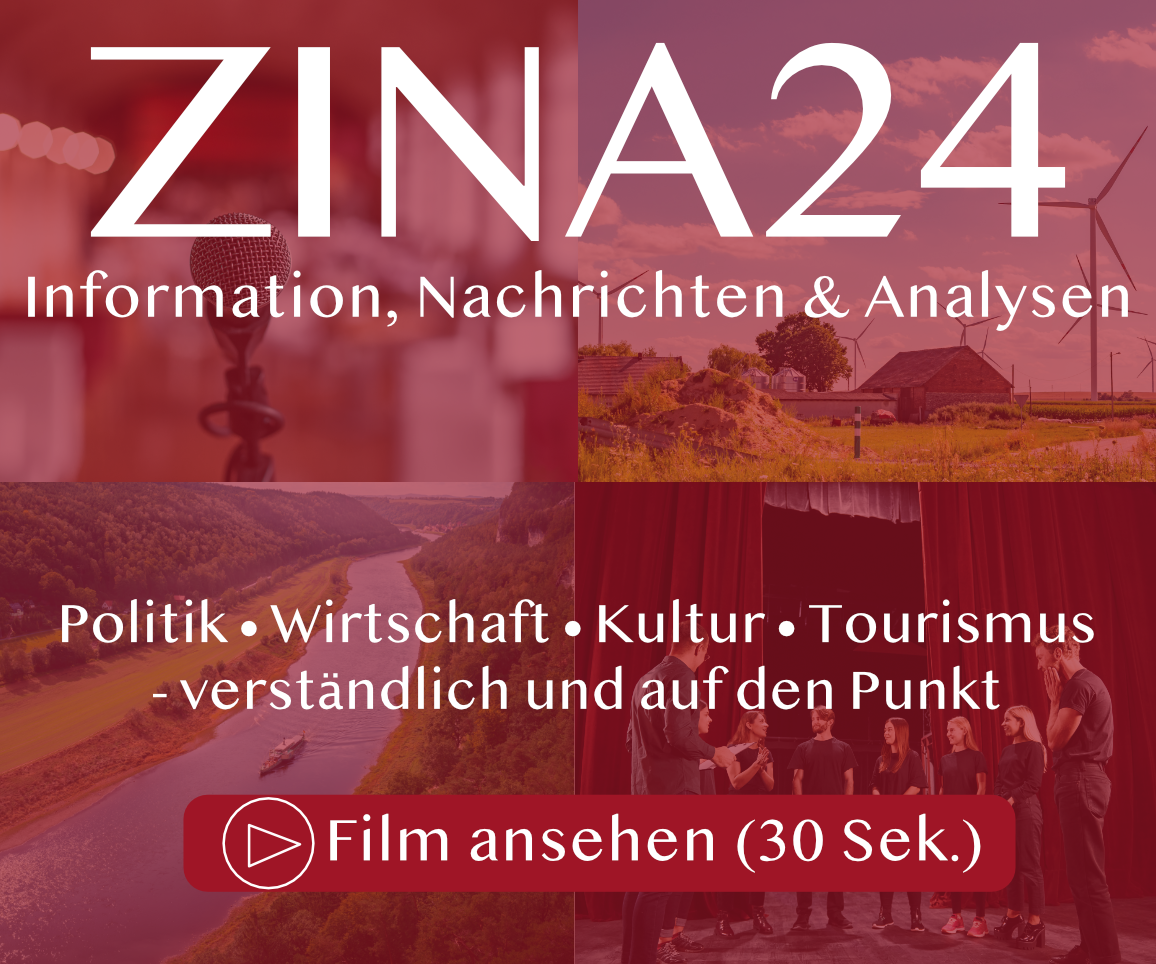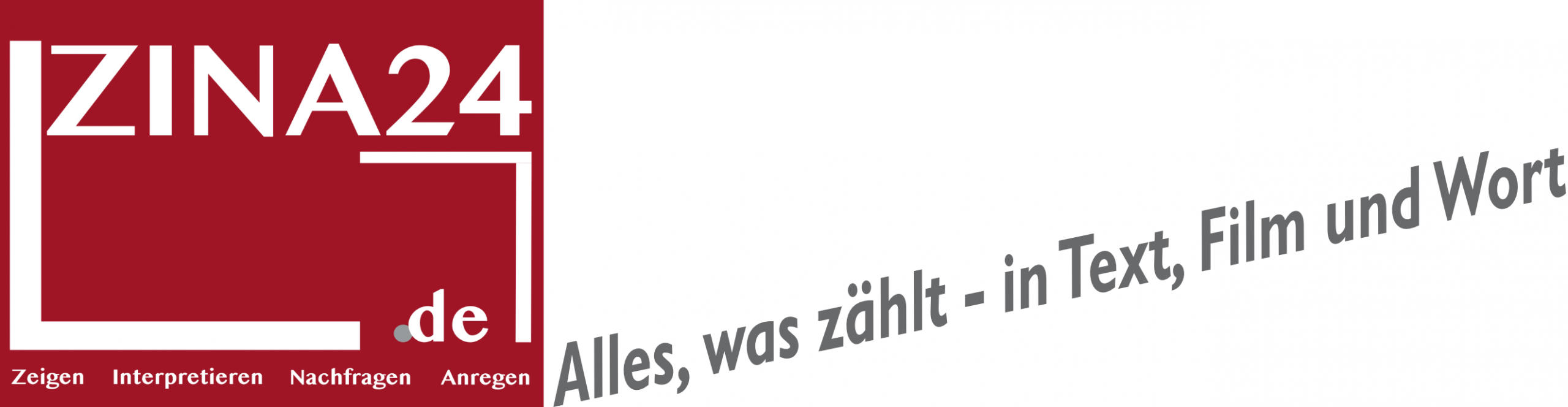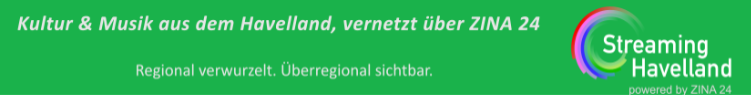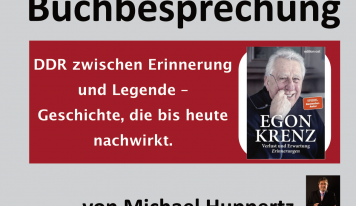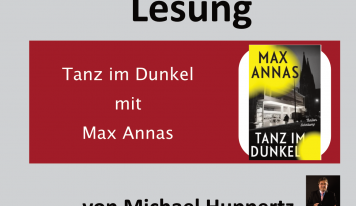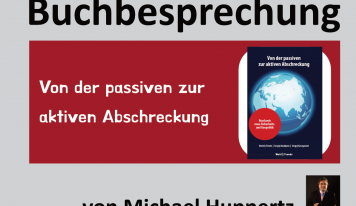von Holger Fuchs · Christian Groß · Marcus H.V. Lohr · Christoph Meineke
(Springer Vieweg, 2025)
Dies ist die zweite Buchbesprechung von Zina24 – und es geht diesmal nicht um leichte Kost, sondern um ein Werk, das man nicht liest, um sich zu entspannen, sondern um sich Wissen für den politischen Diskurs anzueignen. Denn die Wärmewende ist keine Wellnessübung, sondern eine harte, technisch-ökonomische Transformation, die unser Land in den kommenden Jahrzehnten prägen wird.
Wissen = Handeln – der Weckruf des Vorworts
Dirk Specht eröffnet das Buch mit einer Diagnose, die man nicht wegwischen kann: „Wissen ist nicht gleich Handeln.“ Während die Naturwissenschaften eine stabile Wissensbasis schaffen, gelingt es Politik und Gesellschaft nicht, dieses Wissen in konkrete Entscheidungen zu übersetzen. Die Physik, so Specht, verhandelt nicht – sie zwingt uns zum Handeln. Wer die Transformation aufschiebt, kauft sich keine Zeit, sondern höhere Kosten.
Vier Autoren, drei Berührungspunkte
Die vier Herausgeber kommen aus unterschiedlichen Richtungen: Holger Fuchs betrachtet das Thema aus Sicht der Psychologie, Christian Groß bringt Technik und Kultur ein, Marcus H.V. Lohr entwickelt Geschäftsmodelle für Industrie und Gebäude, Christoph Meineke steuert die kommunale Praxis bei. Unterschiedliche Denkansätze – aber dasselbe Ziel: die Wärmewende dezentral, pragmatisch und realistisch voranbringen.
Warum kommunale Wärmeplanung?
Die Wärmewende entscheidet sich nicht in Brüssel oder Berlin, sondern in Rathäusern. Kommunale Wärmeplanung ist kein bürokratischer Selbstzweck, sondern der Schlüssel, um lokale Energiequellen mit lokaler Nachfrage zu verbinden. Christoph Meineke formuliert es klar: „Die Kommune ist Trägerin der Wärmeplanung. Sie muss steuern, moderieren und umsetzen – doch ohne Ressourcen, Fachkräfte und klare Finanzierung bleibt das Anspruch ohne Wirkung.“
In Hannover wurde vorgemacht, wie das geht: Dort wurde die Fernwärme systematisch „vergrünt“ – fossile Kraftwerke werden Schritt für Schritt durch eine Flusswärmepumpe, ein Abfall- und Biomasse-Heizkraftwerk und den Ausbau erneuerbarer Quellen ersetzt. Parallel läuft Bürgerbeteiligung, und die Stadtwerke übernehmen die Rolle des Koordinators. Hannover zeigt: Wärmewende ist machbar – wenn man sie ernsthaft plant.
Teuer? Nein – teuer ist das Abwarten
„Grüner Wahnsinn“, sagen Kritiker, „unbezahlbar für den Normalbürger“. Doch die Zahlen im Buch sprechen eine andere Sprache:
- Deutschland gab in Spitzenjahren über 110 Milliarden Euro jährlich für fossile Importe aus.
- Klimaschäden könnten bis 2050 auf 900 Milliarden Euro steigen.
- Der Investitionsbedarf für die Wärmewende liegt bei 800 bis 1.000 Milliarden Euro – über 20 Jahre verteilt.
Die Rechnung ist eindeutig: Nicht die Umsetzung, sondern das Unterlassen ist unbezahlbar. Marcus H.V. Lohr erklärt, warum das trotzdem so schwer zu vermitteln ist: Menschen gewichten kurzfristige Kosten stärker als langfristige Schäden. Darum sehen sie die Wärmepumpe als Belastung – und die Milliardenverluste durch Klimafolgen als abstrakte Größe.
Technik als Baukasten
Die technische Umsetzung wird im Buch nicht als Dogma, sondern als Baukasten beschrieben: Wärmepumpen, Wärmenetze, Speicher, Power-to-Heat, Wasserstoff, Synthesegase aus Reststoffen, digitale Steuerungen. Jede Kommune setzt die Teile ein, die zu ihren Potenzialen passen.
Christian Groß fordert dabei: „Hybrid denken, nicht alles bis zum Ende durchplanen, Bottom-up handeln – die Wärmewende ist ein Puzzle, das mit dezentralen Bausteinen zusammengesetzt wird.“
Marcus H.V. Lohr zeigt, wie daraus Geschäftsmodelle entstehen – von Quartiers-Contracting bis Kreislaufwirtschaft. Selbst in der Zementindustrie, Symbol der CO₂-Intensität, eröffnen sich neue Pfade mit grünem Wasserstoff und Reststoffnutzung.
Wer zahlt? Und was ist Verzerrung?
Die Finanzierung ist vielfältig – und komplexer, als es Schlagzeilen oft suggerieren:
- Bund und Länder stellen Fördermittel und Rechtsrahmen.
- Kommunen koordinieren, planen, beteiligen.
- Private Investoren bringen Kapital für Netze, Speicher und Erzeugung.
Die öffentliche Debatte verzerrt dieses Bild häufig: Wenn von „Kosten der Wärmewende“ die Rede ist, werden staatliche Zuschüsse, Investorenkapital und Nutzerentgelte einfach zusammengerechnet. Doch Investorengelder sind kein Staatsdefizit. Sie fließen in regulierte Geschäftsmodelle und tragen Risiko. Entscheidend ist die faire Verteilung: Fördermittel für soziale Härten, klare Regeln für Investoren, Transparenz bei Nutzerpreisen.
Holger Fuchs fordert deshalb ein neues Marktdesign: CO₂-Preise, Abbau von Marktverzerrungen, gezielte Förderung. Nur dann gilt die Formel: „Profitabel, weil nachhaltig.“
Fazit
„Dezentrale Wärmeversorgung“ ist ein Handbuch der Wärmewende. Keine schnelle Anleitung, kein grünes Wunschdenken, sondern eine interdisziplinäre Vermessung des Projekts: Psychologie und Markt (Fuchs), Technik und Kultur (Groß), Wirtschaft und Industrie (Lohr), Kommunalpolitik (Meineke).
Die Botschaft ist klar: Wärmewende ist machbar, sie ist bezahlbar – und sie ist unvermeidlich. Oder, wie Dirk Specht im Vorwort formuliert: „Teuer ist nicht die Transformation – teuer ist das Abwarten.“
Als Ebook €39,99 oder Softcover Ausgabe €49,99 erhältlich.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-48023-3