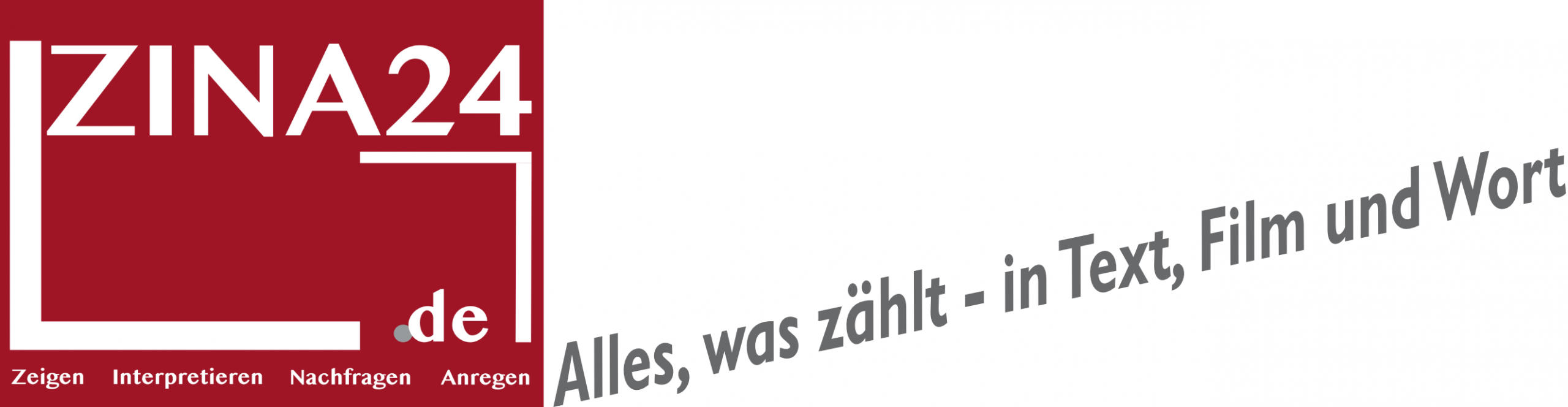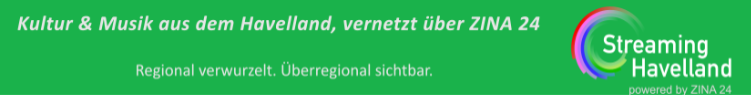Titelfoto: Lukas Barth / MSC
Die Münchner Sicherheitskonferenz war in diesem Jahr mehr als ein diplomatisches Forum. Sie war ein Resonanzraum für vier unterschiedliche Deutungen der Weltlage – und damit ein Gradmesser für die strategische Neuordnung einer Zeit, in der Gewissheiten brüchig geworden sind.
Wir haben vier zentrale Reden aufmerksam verfolgt: Friedrich Merz mit seiner Diagnose einer zurückkehrenden Großmachtpolitik, Marco Rubio mit seinem zivilisatorischen Selbstverständnis des Westens, Wang Yi mit dem Plädoyer für multilaterale Ordnung aus chinesischer Perspektive und Ursula von der Leyen mit der Forderung nach strategischer europäischer Unabhängigkeit.
Jede dieser Reden steht für ein eigenes Ordnungsmodell. Jede formuliert einen Anspruch – auf Sicherheit, auf Stabilität, auf Souveränität oder auf strategische Autonomie. Gemeinsam zeichnen sie das Bild einer Welt, die nicht mehr von einer dominierenden Erzählung getragen wird, sondern von konkurrierenden Konzepten politischer Legitimation.
Worauf kommt es nun an? Welche Linien sind rhetorisch – und welche strategisch belastbar? Wie lässt sich in einem Geflecht aus Bündnistreue, Systemwettbewerb und globaler Verflechtung ein stabiler Friedensprozess gestalten? Und vor allem: Entsteht aus diesen Positionierungen Bewegung – oder verharren sie im Modus der Selbstvergewisserung?
Dieser Beitrag versucht, die Aussagen zusammenzuführen, Differenzen offenzulegen und die entscheidende Frage zu stellen: Ob aus dieser Konferenz mehr erwächst als symbolische Präsenz – nämlich konkrete Schritte auf dem Weg zu einer friedlicheren Ordnung.

Als Friedrich Merz am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet, ist seine Grundsatzrede präzise gesetzt, sorgfältig formuliert, strategisch durchdacht. Die Diagnose sitzt:
© Foto: Marc Conzelmann / MSC
Die regelbasierte Ordnung, wie Europa sie über Jahrzehnte kannte, existiere in dieser Form nicht mehr. Großmachtpolitik sei zurück – offen, strategisch, machtbewusst. Russland führe einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. China formuliere einen globalen Gestaltungsanspruch. Die Vereinigten Staaten seien nicht länger die unangefochtene Führungsmacht. Das ist analytisch klar. Aber genau hier beginnt die Leerstelle. Merz spricht von einem „normativen Überschuss“ deutscher Außenpolitik – viel moralischer Anspruch, zu wenig machtpolitische Unterfütterung. Diese Schieflage müsse korrigiert werden. Deutschland werde militärisch und technologisch aufrüsten, die Verteidigungsindustrie stärken, Europa innerhalb der NATO zu einem tragfähigen Pfeiler entwickeln.
Die Richtung ist klar – der Weg bleibt skizzenhaft.
Doch wie genau? Mit welchen Prioritäten? Mit welchem finanziellen Rahmen jenseits allgemeiner Aufstockungen? Welche industriepolitischen Instrumente, welche strategischen Partnerschaften, welche institutionellen Reformen sollen diese Wende tragen?
Auch beim Thema China bleibt es bei der Beschreibung des Problems. Merz charakterisiert Peking als strategisch geduldigen Akteur, der Abhängigkeiten systematisch nutze. Das ist zutreffend analysiert. Aber welche Gegenstrategie folgt daraus? Diversifizierung? Technologische Souveränität? Gezielte Industriesubventionen? Neue Handelsarchitekturen? Eine abgestimmte europäische Investitionskontrolle?
Diagnose ohne Bauplan
Die Rede benennt die Herausforderung, doch sie liefert kein konkretes Instrumentarium. Sein Leitmotiv lautet: Verantwortung übernehmen, ohne hegemonial aufzutreten. Führung ja, Dominanz nein. Das ist politisch klug formuliert – gerade gegenüber kleineren EU-Staaten. Aber Führung bedeutet Struktur. Führung verlangt Priorisierung. Führung braucht einen operationalisierten Plan.
Hier bleibt offen, ob es sich um eine bewusst diplomatische Zurückhaltung handelt oder um das Fehlen eines ausformulierten strategischen Bauplans. Die Rede ist stark in der Diagnose und klar im Anspruch. Was fehlt, ist die Blaupause. Und genau das ist die entscheidende Frage: Stehen wir vor einer strategischen Neuaufstellung – oder vor einer rhetorischen Selbstvergewisserung in Zeiten wachsender Unsicherheit?
Marco Rubio – Zivilisation, Souveränität und die scharfe Kante des Wortes „Feind“

Am Samstagmorgen verändert sich die Atmosphäre im Saal spürbar. Marco Rubio betritt unter starkem Applaus die Bühne, am Ende steht das Publikum. Seine Rede ist rhetorisch geschlossen, historisch unterfüttert, politisch zugespitzt.
© Foto: Thomas Niedermüller / MSC
Er beginnt mit 1963, mit der Kubakrise, mit Deutschland als geopolitischer Bruchlinie. Damals habe der Westen zusammengehalten. Genau diese Geschlossenheit beschwört er erneut.
„Wir kommen hier heute zusammen als Mitglieder eines historischen Bündnisses, das die Welt verändert und geschützt hat.“ Rubio unternimmt eine Zeitreise in die Vergangenheit, in die Gründerzeit der USA, rund 250 Jahre zurück. Europäische Siedler hätten nicht nur Territorium erschlossen, sondern Werte mitgebracht. Er spricht ausdrücklich von einer westlichen Zivilisation, verbunden „durch den christlichen Glauben, durch Kultur, kulturelles Erbe, durch Sprache und deren Vergangenheit“. Hier beginnt jedoch die erste grundlegende Frage.
Politik und Religion
Kann westliche Politik im 21. Jahrhundert auf christliche Religionsgrundsätze gegründet werden? Europa – insbesondere Deutschland – kennt nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch Religionsfreiheit. Das deutsche Grundgesetz schützt die Freiheit des Glaubens ebenso wie die Freiheit, keinen Glauben zu haben. Der Staat ist weltanschaulich neutral. Die europäische Union definiert sich über Rechtsstaatlichkeit und Pluralismus, nicht über eine religiöse Identität.
Wenn transatlantische Partnerschaft zivilisatorisch-religiös begründet wird, berührt das zwangsläufig die Frage nach Inklusion: Was ist mit säkularen Gesellschaften? Mit jüdischen, muslimischen, hinduistischen, buddhistischen Bürgern? Mit Millionen Menschen ohne religiöse Bindung? Ist das ein identitätsstiftender Verweis – oder eine politische Engführung?
Rubio wendet sich in seiner Rede auch den internationalen Institutionen zu, insbesondere den Vereinten Nationen. Sinngemäß macht er deutlich, dass die UNO auf viele der zentralen Krisen der Gegenwart keine wirksamen Antworten gefunden habe. Dort, wo multilaterale Prozesse blockiert gewesen seien, hätten – so seine Argumentation – die Vereinigten Staaten gehandelt. Ordnung und Stabilität seien nicht durch Resolutionen entstanden, sondern durch konkretes Eingreifen.Diese Sichtweise markiert einen klaren Machtanspruch: Handlungsfähigkeit zählt mehr als institutionelle Verfahren. Gleichzeitig bleibt ein Spannungsverhältnis unausgesprochen. Denn die USA haben sich in den vergangenen Jahren aus mehreren UN-Gremien zurückgezogen oder ihre Mitarbeit ausgesetzt – trotz der Tatsache, dass sie zu den Gründungsstaaten der Vereinten Nationen gehören und das multilaterale System nach 1945 maßgeblich mit aufgebaut haben. Rubio erwähnt diesen Rückzug nicht. Auch die von Donald Trump propagierte „America-First“-Linie oder die massive finanzielle Umschichtung weg von multilateralen Strukturen tauchen in seiner Rede nicht explizit auf. Stattdessen bleibt der Fokus auf dem Vorwurf institutioneller Schwäche – und auf der Schlussfolgerung, dass amerikanisches Handeln dort notwendig geworden sei, wo die UNO versagt habe.
Damit entsteht ein bekanntes Muster: Multilaterale Ordnung wird rhetorisch eingefordert, gleichzeitig aber durch selektive Beteiligung geschwächt. Die Frage, ob internationale Institutionen handlungsfähiger würden, wenn ihre wichtigsten Architekten sich konsequent einbrächten, bleibt unbeantwortet. An diesem Punkt verschiebt sich die Tonlage der Rede noch einmal. Weg von institutioneller Kritik, hin zu klarer Frontstellung. Rubio spricht nun von „Feinden“, die mit Energieexporten ihre Wirtschaft und zugleich ihre militärische Macht gestärkt hätten. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges spricht vieles dafür, dass er hier insbesondere Russland meint. Doch der Begriff bleibt unscharf – und öffnet Interpretationsräume.
Freund und Feind
Gerade weil Länder wie Russland – und teilweise auch Kasachstan – geografisch auf dem europäischen Kontinent liegen, politisch jedoch nicht Teil der Europäischen Union sind, entsteht hier eine feine, aber entscheidende Differenz. Europa ist nicht deckungsgleich mit der EU. Und nicht jeder Staat außerhalb der EU ist automatisch Gegner. Kasachstan etwa liefert heute Rohöl an die PCK-Raffinerie in Schwedt – als Teil der europäischen Diversifizierungsstrategie nach dem Wegfall russischer Lieferungen. Es verfolgt eine Multi-Vektor-Außenpolitik und sucht wirtschaftliche Kooperation mit Brüssel. Wer solche Staaten pauschal unter den Begriff „Feind“ fasst, verwischt geopolitische Realität.
Das gilt umso mehr für strategische Rohstoffe. Bei seltenen Erden etwa ist Europa – ebenso wie die USA – trotz eigener Vorkommen in hohem Maße auf Importe und externe Verarbeitungskapazitäten angewiesen. Die globale Wertschöpfung liegt bislang überwiegend außerhalb westlicher Kontrolle. Die Frage drängt sich auf: Kann man Staaten, denen man politisch misstraut, zugleich als unverzichtbare Lieferanten behandeln? Oder anders formuliert – wie tragfähig ist eine Sicherheitsdoktrin, die Abhängigkeiten rhetorisch verurteilt, während industrielle Realität weiterhin auf genau diese Abhängigkeiten angewiesen ist? Hier liegt das Dilemma der Rhetorik: „Feind“ ist kein analytischer Begriff wie „Wettbewerber“ oder „systemischer Rivale“. Er markiert Frontlinien. Diplomatie hingegen lebt von Abstufung. Zwischen militärischem Aggressor und energiepolitischem Partner besteht ein fundamentaler Unterschied – auch dann, wenn beide geografisch zu Europa gehören, aber politisch außerhalb der EU stehen.
Reizthema Klima
Rubio spricht zudem von einem „Klima-Kult“ und kritisiert westliche Maßnahmen zur Emissionsreduktion. Diese Linie korrespondiert mit Dekreten aus Washington, die unter Präsident Trump formuliert wurden, um – so die Wortwahl – den „Klima-Wahnsinn“ zu stoppen und regulatorische Beschränkungen zurückzufahren. Gleichzeitig investieren Staaten wie China, Indien oder auch Pakistan massiv in erneuerbare Energien und CO₂-Reduktion – nicht primär aus moralischen Gründen, sondern aus industrie- und technologiepolitischem Kalkül. Hier entsteht ein strategischer Widerspruch: Wenn ein Teil des Westens Klimaschutz relativiert, während große Schwellenländer diesen Sektor als Zukunftsmarkt definieren, verschiebt sich das industrielle Kräfteverhältnis. Kann unter solchen gegensätzlichen Ansätzen eine stabile Partnerschaft aufrechterhalten werden? Oder entstehen neue ökonomische Asymmetrien?
Rubio betont zugleich die transatlantische Verbundenheit und formuliert: „Wenn wir mal nicht einer Meinung sind, dann liegt das an unserer Sorge um Europa, mit dem wir verbunden sind – nicht nur wirtschaftlich, nicht nur militärisch. Wir sind auch spirituell und kulturell verbunden.“ Das ist versöhnlicher als der Tonfall, den man vor einem Jahr hörte. Damals hatte J.D. Vance in München im politischen Alltag angesetzt und behauptet, Meinungsfreiheit sei in Deutschland faktisch eingeschränkt. Diese Zuspitzung war deutlich konfrontativer. Rubio wirkt in diesem Jahr moderater, weniger frontal, stärker strategisch argumentierend. Doch die Grundfrage bleibt bestehen: Wie belastbar ist eine Partnerschaft, wenn zentrale normative Annahmen – über Klimapolitik, über gesellschaftliche Offenheit, über den Umgang mit internationalen Institutionen – auseinanderdriften?
Standing Ovation
Trotz der Standing Ovation und der versöhnlich formulierten Handreichung bleiben zwischen den Zeilen Fragen, die nicht vollständig in einen gemeinsamen westlichen Konsens passen. Die Berufung auf christliche Werte als identitätsstiftende Grundlage wirft ebenso grundsätzliche Überlegungen auf wie die wiederholte Verwendung des Begriffs „Feind“. Ist eine solche Begrifflichkeit im 21. Jahrhundert noch zeitgemäß? Oder verstärkt sie Frontlinien in einer Welt, die wirtschaftlich, technologisch und energiepolitisch längst tief verflochten ist? Sind Staaten heute tatsächlich noch klar trennbar in Freund und Feind – oder leben wir in einem Geflecht gegenseitiger Abhängigkeiten, in dem Kooperation und Konkurrenz gleichzeitig existieren? Kann strategische Sicherheitspolitik mit globalen Lieferketten, Rohstoffabhängigkeiten und multilateralen Institutionen vereinbart werden, ohne in Widersprüche zu geraten?
Wang Yi – Geste, Diplomatie und das Versprechen der Ordnung

Als der chinesische Aussenminister Wang Yi nach Marco Rubio die Bühne betritt, verändert sich erneut die Dynamik. Mit dem Aufruf seines Namens als nächster Redner erhebt er sich von seinem Platz in der ersten Reihe.
© Foto: Nils Hagenau / MSC
Noch bevor er sich in Bewegung setzt, folgt eine kurze, leichte Verbeugung – ein höfliches Zeichen gegenüber dem Saal. Dann geht er gelassen die wenigen Stufen zum Podium hinauf. Er tritt nicht sofort hinter das Rednerpult, sondern geht daran vorbei, stellt sich bewusst daneben und verharrt einen Moment. Er blickt ins Auditorium, lässt den Raum still werden – und neigt dann den Oberkörper etwa dreißig Grad nach vorne. Es ist keine beiläufige Geste, sondern ein bewusst gesetztes Zeichen. Vor einem weltweiten Forum, vor Vertretern aus Politik, Militär und Wirtschaft, signalisiert der chinesische Außenminister damit Achtung, nicht Unterordnung – nicht nur gegenüber dem Publikum, sondern gegenüber der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Gesten dieser Art sind selten in westlichen diplomatischen Ritualen. Sie sprechen eine eigene Sprache. Erst danach tritt er hinter das Rednerpult und beginnt seine Rede.
Tradition und der lange Horizont
Wang beginnt mit einer Diagnose, die sich deutlich von Rubio unterscheidet. Die internationale Politik habe sich zuletzt am „Recht des Stärkeren“ orientiert. Die Menschheit stehe an einem Scheideweg zwischen Konfrontation und Kooperation. China wolle „für die gesamte Menschheit einen Kompass mitentwickeln“ und das „Schiff der gemeinsamen Geschichte auf den richtigen Kurs steuern“. Seine Argumentation ist nicht nur politisch, sondern kulturhistorisch gerahmt. Wang verweist auf eine lange Tradition chinesischen Denkens seit der Antike, wie er betont, in der Harmonie, Ausgleich und Ordnung zentrale Kategorien sind – eine Denktradition, die bis zu Konfuzius zurückreicht. Geschichte versteht er nicht als rhetorisches Instrument, sondern als gewachsenes Kulturgut, als Orientierungsrahmen staatlichen Handelns. Stabilität entsteht aus Kontinuität.
UNO – Schutzschirm für kleine und schwächere Staaten
Im Zentrum seiner Rede steht die UNO. Sie sei das stärkste Instrument, das die Welt habe – reformbedürftig, aber unverzichtbar. Ohne multilaterale Ordnung drohe eine Rückkehr zur reinen Machtpolitik. „Einheit bedeutet Stärke“, sagt er. Während Rubio institutionelle Schwäche betont, verteidigt Wang die multilaterale Architektur als notwendiges Gegengewicht zur Dominanz einzelner Staaten.Zum Ukraine-Krieg äußert er sich zurückhaltend, vermeidet direkte Schuldzuweisungen, betont jedoch, dass chinesische Diplomaten im Hintergrund Gespräche führten. Die Diplomatie arbeite – nicht laut, nicht öffentlichkeitswirksam, sondern hinter verschlossenen Türen. Stabilität entstehe nicht durch Konfrontation, sondern durch Gespräch.
Taiwan – Spannungsfall im pazifischen Raum
Gleichzeitig verweist Wang auf interne Sicherheitsabkommen und regionale Kooperationsformate in Asien, die eine friedliche Koexistenz ermöglichen sollen. Doch er belässt es nicht bei Stabilitätsrhetorik. Er spricht auch von strategischer Planung. China folge einem langfristigen Entwicklungspfad, betont er, und verweist auf den neuen 15-Jahres-Plan, der nationale Modernisierung sichern und zugleich globale Impulse setzen solle. Dieser Kurs sei politisch festgelegt und werde konsequent umgesetzt – weil er sich über Jahre bewährt habe.
Im anschließenden Dialog greift der Leiter der Sicherheitskonferenz Konferenz Wolfgang Ischinger die Taiwan-Frage auf. Wang antwortet ohne Zögern. Taiwan sei Teil der chinesischen Souveränität. Jede Einmischung von außen werde man nicht akzeptieren. Seine Worte sind nüchtern, aber eindeutig – ein klarer Hinweis auch auf jüngste Äußerungen aus Japan, die in Peking aufmerksam registriert wurden. Hier markiert China eine rote Linie.
Strukturelle Unterschiede – Herausforderung und Chancen zugleich
Damit wird ein struktureller Unterschied sichtbar. Während westliche Demokratien durch Wahlzyklen, Regierungswechsel und gesellschaftliche Aushandlungsprozesse geprägt sind, präsentiert China Kontinuität als Stärke. Planung ersetzt politischen Wettbewerb. Stabilität entsteht nicht durch Mehrheitswechsel, sondern durch langfristige Steuerung. Daraus ergeben sich Fragen, die über den Moment hinausreichen: Entsteht hier ein alternatives Ordnungsmodell, das nicht auf individueller Freiheitslogik, sondern auf kollektiv verstandener Entwicklung basiert? Kann eine solche staatlich gelenkte Kontinuität dauerhaft neben westlicher Demokratie bestehen? Oder verschärft sich der Systemwettbewerb zwangsläufig?
Wang argumentiert aus einer über Jahrtausende gewachsenen Staatstradition heraus. Sie korrespondiert nicht mit westlichen Demokratievorstellungen – aber sie ist politisch wirksam und strategisch konsistent. Man könnte es mit einem Korallenriff vergleichen: Erst das Zusammenspiel von Mikroorganismen, Kalk und Strömung schafft ein stabiles Gebilde. Fehlt ein Element, zerbricht die Struktur. Vielleicht verhält es sich ähnlich mit der internationalen Ordnung – unterschiedliche Systeme, verschiedene politische Organismen, die nicht identisch sind, aber in einer Art funktionaler Symbiose existieren könnten.
Die Frage ist nicht, ob beide Systeme identisch sind. Die Frage ist, ob sie koexistieren können, ohne sich gegenseitig zu delegitimieren. Und damit richtet sich der Blick erneut nach Europa und in den transatlantischen Raum: Wird sich der Westen auf eine multipolare Welt einstellen müssen, in der unterschiedliche politische Grundordnungen parallel existieren? Oder bleibt der Anspruch bestehen, dass nur ein Modell universelle Gültigkeit beanspruchen darf?
Ursula von der Leyen – Unabhängigkeit als strategischer Imperativ

Als Ursula von der Leyen schließlich spricht, richtet sich der Blick wieder auf Europa selbst – nicht als Zuschauer zwischen Washington und Peking, sondern als eigenständiger Akteur. Ihre Diagnose ist klar: Seit beinahe vier Jahren führe Russland seinen „rücksichtslosen Angriffskrieg“ gegen die Ukraine. Zugleich erlebe Europa eine „Wiederkehr eines offen feindseligen Konkurrenzkampfs und Machtstrebens“. Territoriale Ansprüche, Zölle, technologische Regulierung – Macht werde wieder offensiv eingesetzt.
© Foto: Johannes Krey / MSC
Die Schlussfolgerung formuliert sie unmissverständlich: „Europa muss unabhängiger werden – wir haben keine andere Wahl.“ Unabhängigkeit bedeute Handlungsfähigkeit in allen sicherheitsrelevanten Bereichen – Verteidigung, Energie, Wirtschaft, Rohstoffe, digitale Technologien. Wer darin einen Bruch mit den USA sehe, liege falsch. „Ein unabhängiges Europa ist ein starkes Europa. Und ein starkes Europa führt zu einem stärkeren transatlantischen Bündnis.“ Doch was bedeutet diese Unabhängigkeit konkret? Geht es um Risikoreduzierung – oder um strukturelle Entkopplung in einzelnen Bereichen? Und wie weit kann strategische Autonomie reichen, ohne das transatlantische Gefüge neu zu justieren?
Von der Leyen nennt Zahlen: Verteidigungsausgaben 2025 fast 80 Prozent über Vorkriegsniveau, Mobilisierung von bis zu 800 Milliarden Euro, SAFE-Programm, 90 Milliarden Euro Darlehen für die Ukraine. Europa sei „aufgewacht“. Gleichzeitig wirft diese Dimension eine politische Anschlussfrage auf: Sind solche Summen langfristig konsensfähig – auch dann, wenn wirtschaftlicher Druck oder soziale Spannungen wachsen? Wer trägt die Last, und wie bleibt der innere Zusammenhalt gewahrt?Institutionell fordert sie, Artikel 42 Absatz 7 – die Beistandsklausel – ernst zu nehmen: „Einer für alle und alle für einen. Das bedeutet Europa.“ Schnellere Entscheidungen, notfalls mit qualifizierter Mehrheit. Doch auch hier stellt sich eine strukturelle Frage: Wächst ein handlungsfähiger Kern – oder entsteht eine neue Trennlinie zwischen integrationsbereiten Staaten und jenen, die sicherheitspolitisch andere Prioritäten setzen?
Sicherheit und Wirtschaft
Ein zentraler Punkt ihrer Rede ist die industrielle Dimension. Sicherheit hänge von Produktionskapazität ab. Die „starre Mauer zwischen dem zivilen und dem Verteidigungssektor“ müsse fallen. Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Dual-Use-Technologien wie KI und Cyber – all das solle Teil einer strategischen Wertschöpfung werden. Doch kann Europa diese Transformation gesellschaftlich vermitteln? Und ist die industrielle Skalierung schnell genug, um mit den Modellen der USA oder Chinas Schritt zu halten?Von der Leyen spricht von einer neuen Sicherheitsdoktrin: Jede politische Entscheidung – ob Handel, Finanzen, Normen oder Infrastruktur – müsse künftig eine Sicherheitsdimension mitdenken. Europa soll nicht mehr nur Wertegemeinschaft sein, sondern Machtfaktor. Daraus ergibt sich die vielleicht entscheidendste Frage: Kann Europa zugleich normative Kraft und geopolitischer Akteur bleiben – oder zwingt die neue Weltlage zu einer Priorisierung zwischen Ideal und Interessenpolitik?
Im Verhältnis zu China bleibt sie bei „De-Risking“ statt Entkopplung, gegenüber Russland klar bei Völkerrecht und territorialer Integrität. Doch Europa ist geografisch selbst Teil des eurasischen Kontinents. Wie wird sich seine Rolle langfristig zwischen Amerika, China und diesem größeren Raum definieren? Am Ende schlägt sie einen normativen Ton an. Mit einem Zitat von Ewald von Kleist erinnert sie daran, dass Frieden und Freiheit untrennbar zusammengehörten. Sicherheit sei kein Selbstzweck, sondern Schutz beider. „Es lebe Europa“, schließt sie.
Eine Konferenz, vier Weltbilder
Die Richtung ist definiert. Die Architektur skizziert.
Doch wie tragfähig ist dieses europäische Projekt, wenn es in der Praxis zwischen Bündnistreue, Eigenständigkeit und globaler Verflechtung austariert werden muss? Was bleibt nach diesen vier Reden, die jeweils eigene Sichtweisen auf Macht, Ordnung und Legitimation dargelegt haben? Keine neue Weltordnung, kein gemeinsames Narrativ – sondern vier unterschiedliche Perspektiven, die nebeneinanderstehen und miteinander ringen.
Friedrich Merz hat den Ausgangspunkt markiert: eine Welt, in der Großmachtpolitik zurückgekehrt ist und Europa seine sicherheitspolitische Rolle neu definieren muss. Seine Diagnose war klar, sein Anspruch deutlich – mehr Verantwortung, weniger normative Selbstgewissheit. Doch sein Beitrag blieb stärker analytisch als operativ, stärker in der Beschreibung der Zeitenwende als in der Ausarbeitung ihres konkreten Instrumentariums. Ursula von der Leyen knüpft daran an, geht jedoch einen Schritt weiter. Für sie ist der institutionelle Rahmen Europas – Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Meinungs- und Religionsfreiheit – nicht nur Identitätsmerkmal, sondern strategische Grundlage. Sicherheit, wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und technologische Souveränität sollen systematisch gestärkt werden – nicht als Abkehr vom transatlantischen Bündnis, sondern als dessen belastbare Ergänzung. Europa argumentiert aus der Logik des Rechts und der strukturellen Stabilität, will jedoch zugleich Machtmittel aufbauen, um diese Ordnung zu schützen.
Marco Rubio hingegen betont im Namen der USA nationale Souveränität und eine zivilisatorische Kontinuität, die – wie Rubio ausdrücklich hervorhob – auch religiös fundiert ist. Identität wird hier historisch und kulturell verortet, Außenpolitik stärker aus dem Selbstverständnis einer gewachsenen Zivilisation heraus begründet.
Wang Yi schließlich stellt Multilateralismus und staatliche Ordnung für China in den Vordergrund. Stabilität, Respekt, diplomatische Einbindung – das sind die wiederkehrenden Begriffe. Legitimation entsteht weniger aus individueller Freiheit als aus staatlicher Handlungsfähigkeit und internationaler Balance.
Damit zeigt die Sicherheitskonferenz 2026 in München nicht nur unterschiedliche Machtentwürfe, sondern unterschiedliche normative Grundlagen politischer Ordnung. Institutionelle Rechtsbindung, zivilisatorische Selbstvergewisserung und staatszentrierte Stabilitätslogik stehen sich gegenüber – nicht zwingend unvereinbar, aber sichtbar verschieden.
Und dennoch: Die Gesprächsfäden reißen nicht ab. Hinter verschlossenen Türen wird weiterverhandelt, insbesondere im Kontext des Ukraine-Krieges. In bilateralen Treffen, in diplomatischen Kanälen, in vertraulichen Runden wird sondiert, ausgelotet, getestet. Solche Foren halten Kommunikationsräume offen, auch wenn die öffentlichen Reden Differenzen betonen.
Die Absichtserklärungen sind formuliert. Der Wille zum Dialog ist erkennbar. Aber wird die Welt dadurch tatsächlich ein Stück friedlicher?Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob aus rhetorischer Annäherung politische Bewegung entsteht. Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Leistung dieser Konferenz: dass sie trotz aller Gegensätze einen Raum geschaffen hat, in dem Gespräch noch möglich ist.